Newsletters
Melden Sie sich hier für unseren Newsletter an.
Bisherige Ausgaben
KI im KMU: Vom WhatsApp-Support zum Wettbewerbsvorteil (November 2025)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Wie kann man den Support für über 200 Roboter mit nur 15 Mitarbeitern sicherstellen – inklusive Geschäftsleitung, Administration und Verkauf?
Genau vor dieser Herausforderung stand die Robobee AG, als sie von Denner den Auftrag erhielt, 200 seiner Filialen mit Putzrobotern auszustatten. Neben der schieren Menge an möglichen Supportanfragen kamen weitere Hürden hinzu: Die Anfragen würden aus allen Landesteilen und somit in den verschiedenen Landessprachen eingehen. Zudem würde die Fluktuation in den Filialen eine stetig wiederkehrende Einführung neuer Mitarbeiter in die Geräte nach sich ziehen.
Putzroboter für Denner

Das Unternehmen fand die Lösung in einer interaktiven KI. Der digitale Support läuft über WhatsApp. Die Anwender in den Filialen erhalten so Hilfe in Echtzeit - verständlich, zielführend und jederzeit abrufbar. Komplizierte Fälle werden automatisch an das Supportteam weitergeleitet. Mitarbeiter greifen nur dann ein, wenn es wirklich nötig ist.
Dieses Beispiel zeigt eindrücklich, welche Möglichkeiten KI auch kleinen Betrieben eröffnet. Im Fall von Robobee ist die Lösung technisch anspruchsvoll wie das Bild unten verdeutlicht und wurde mit Unterstützung eines externen Partners (Coorpix AG) entwickelt.
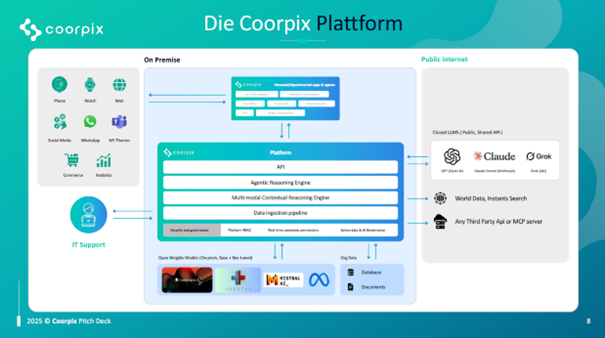
Quelle: Foliensatz Coorpix AG, gezeigt und abgegeben anlässlich des vfTalk 2025 am 19.9.2025 in Brugg
Das muss jedoch nicht immer so sein. Gerade für KMU empfiehlt es sich, zunächst nach einfachen Einstiegsmöglichkeiten mit schnellen Erfolgen zu suchen.
Viele haben das bereits getan und nutzen KI beispielsweise zum Verfassen von Produktbeschreibungen, für die Korrespondenz, Übersetzungen oder für die Erstellung von Präsentationen. Andere gehen noch einen Schritt weiter und analysieren damit strukturierte und unstrukturierte Daten, etwa Kundenfeedbacks.
Doch ab einem gewissen Punkt reicht einfaches Ausprobieren nicht mehr aus. Dann braucht es eine systematische Vorgehensweise, bei der konkrete Anwendungsfälle identifiziert, priorisiert und in klar geführten Projekten umgesetzt werden – so wie bei Robobee.
Die grossen Vorteile von KI sind kurz zusammengefasst Geschwindigkeit und Verfügbarkeit. Sie erledigt viele Aufgaben schneller und präziser als Menschen und wird dabei nie müde. Laut einer Studie von PwC in Genf berichten KMU von gestiegener Produktivität und verbesserter Qualität. Zudem erwarten sie durch die Integration von KI ein Umsatzwachstum.
Die Tendenz ist klar: Unternehmen, die KI richtig und gezielt einsetzen, verschaffen sich nicht nur Vorteile gegenüber ihren unmittelbaren Konkurrenten, sondern erschliessen sich auch völlig neue Möglichkeiten. Robobee ist das beste Beispiel dafür – wer hätte gedacht, dass man 200 Roboter mit einem so kleinen Team erfolgreich betreuen kann?
Die entscheidende Frage lautet: Wer nutzt diesen Vorsprung zuerst?
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
SWOT-Analyse oder das Zusammenspiel der Kräfte (September 2025)
5. Teil der Strategiereihe
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Wenn ein Schweizer Maschinenbauer plötzlich mit 39% Zöllen auf seine Exporte in die USA rechnen muss, wird aus einer bisherigen Stärke – der Fokus auf den amerikanischen Markt – schnell eine Schwäche. Umgekehrt kann Lonza, die Pharmazuliefererin, mit ihren Überkapazitäten in den USA diese Geschehnisse zu ihrem Vorteil nutzen.
Externe Entwicklungen dürfen nicht isoliert beurteilt werden. Erst aufgrund ihrer Bedeutung für das Unternehmen und den Wechselwirkungen mit dessen Stärken und Schwächen zeigt sich ihr wahrer Einfluss.
In den letzten beiden Newsletter haben wir uns mit der Unternehmensanalyse (Blick nach innen) und der externen Analyse (Blick nach aussen) beschäftigt. Die SWOT-Analyse (SWOT für Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) verbindet diese beiden Betrachtungsweisen.
Sie bildet damit zusammen mit den Vorgaben und Werthaltungen der Eigentümer den letzten Baustein des Analyseteils im Strategieentwicklungsprozess.
Strategieentwicklungsprozess
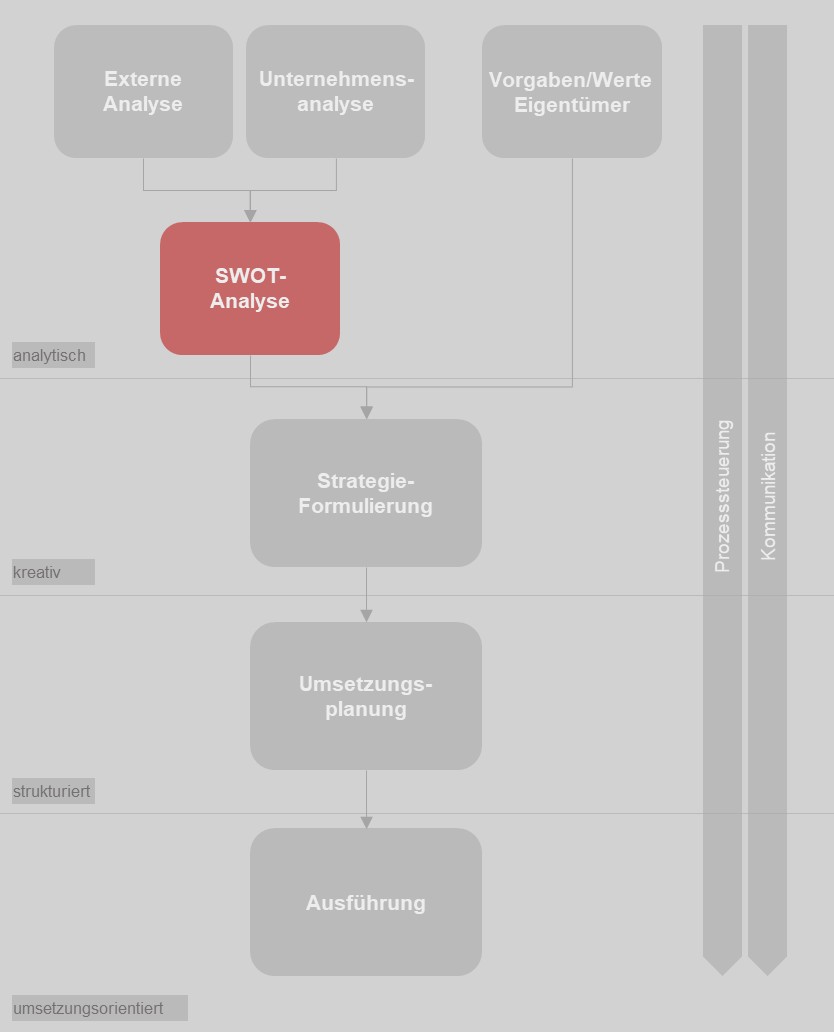
Durch die tabellarische bzw. grafische Darstellung werden mit der SWOT-Analyse relevante Zusammenhänge auf einfache und übersichtliche Weise begreifbar
Die folgende Abbildung zeigt eine SWOT-Analyse für einen mittelgrossen Zulieferer der Automobilindustrie.
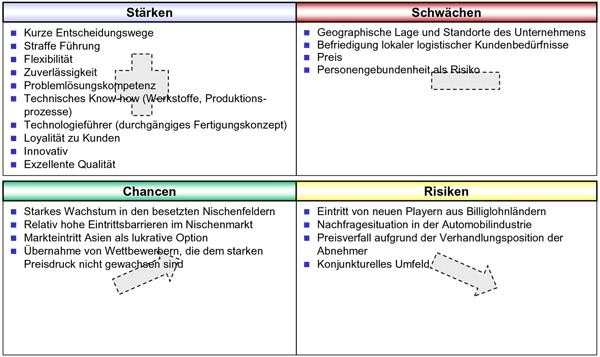
Quelle: https://www.controlling-wiki.com/de/index.php/SWOT-Analyse
Wie die beiden Beispiele am Anfang des Textes zeigen, ist der Kontext der Analyse von grösster Relevanz. Aus Ihnen wird auch rasch ersichtlich, dass eine SWOT-Analyse immer eine Momentaufnahme darstellt. Die plötzliche Einführung von exorbitanten Zöllen auf einem wichtigen Markt, kann die Welt für betroffene Unternehmen komplett verändern.
Obwohl oder vielleicht, gerade weil das Erstellen einer SWOT-Analyse relativ einfach erscheint, wird dabei zuweilen nicht sorgfältig genug vorgegangen. Häufig anzutreffende Fehler sind:
- Mangelnde Objektivität: Meinungen statt Fakten.
- Zu wenig Daten.
- Unsaubere Trennung von Stärken und Chancen beziehungsweise Schwächen und Gefahren.
- Zu vage oder allgemein formuliert und damit nicht fassbar.
- Mangelnde Gewichtung oder Priorisierung der einzelnen Faktoren.
- Keine regelmässige Überprüfung.
Eine gute SWOT-Analyse geht systematisch vor. Sie listet nicht nur ehrlich die eigenen Stärken und Schwächen auf, sondern identifiziert auch die relevanten äusseren Entwicklungen.
Entscheidend ist dann die Bewertung: Wie wahrscheinlich sind diese Entwicklungen? Wie stark würden sie das Unternehmen treffen? Und vor allem: Wo entstehen durch das Aufeinandertreffen von internen und externen Faktoren die wichtigsten Handlungsfelder?
Diese Verbindungen bewusst zu suchen und durchzudenken, ist der eigentliche Wert der SWOT-Analyse. Sie ist kein Selbstzweck, sondern hilft dabei, die begrenzten Ressourcen dort einzusetzen, wo sie die grösste Wirkung entfalten können. Sie zeigt auf, welche Chancen mit den vorhandenen Stärken am besten zu nutzen sind und wo dringend Schwächen behoben werden müssen, bevor äussere Entwicklungen gefährlich werden.
In einem der folgenden Newsletter werden wir aufzeigen, wie Sie aus Ihrer SWOT-Analyse konkrete strategische Optionen und Massnahmen ableiten können.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
In der Serie zum Thema Strategie bisher erschienen:
-
Wer braucht schon eine Strategie? (Oktober 2022)
-
Strategieprozess (Juni 2023)
-
Externe Analyse oder der Blick nach aussen (Januar 2024)
-Unternehmensanalyse oder der Blick nach innen (November 2024)
Navigieren Sie sicher durch den Sturm: Risikomanagement für Macher (Mai 2025)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Hand aufs Herz: Risikomanagement klingt erstmal nicht nach dem spannendsten Thema. Niemand springt vor Freude in die Luft und ruft: "Juhu, heute analysieren wir mal, was alles schiefgehen könnte!" Verständlich. Aber genau das ist es, was erfolgreiche Unternehmer von denen unterscheidet, die ihr Hemd riskieren.
Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Bergwanderung. Die Sonne scheint, der Weg ist trocken und fest. Doch plötzlich ziehen dunkle Wolken auf, und ein dichter Nebel hüllt die Landschaft ein. Würden Sie jetzt blindlings weitergehen, darauf vertrauend, dass schon alles gut geht? Wohl kaum. Sie würden innehalten, die Karte studieren (Risiken identifizieren), die Wettervorhersage checken (Risiken bewerten) und einen alternativen, sicheren Weg suchen (Massnahmen planen). Im Geschäftsleben ist es wie in den Bergen: Wer die Zeichen der Zeit ignoriert, riskiert nicht nur einen vorübergehenden Rückschlag, sondern den Totalverlust.

Das ist Risikomanagement im Unternehmen: ein Kompass und eine Landkarte in einer Zeit, in der sich die wirtschaftlichen und politischen Nebel immer dichter zusammenbrauen. Globale Krisen, geopolitische Spannungen, eine erratisch handelnde amerikanische Regierung, Inflations- und Rezessionsängste - die Liste der Unsicherheiten ist lang und wächst ständig.
Risikomanagement wird oft als notwendiges Übel betrachtet, weil es scheinbar keinen direkten Umsatz bringt. Aber was ist, wenn ein wichtiger Lieferant plötzlich ausfällt und die Produktion stillsteht? Oder ein Cyberangriff die IT lahmlegt? Dann kostet es nicht nur Nerven, sondern gefährdet im schlimmsten Fall die Existenz des Unternehmens. Gutes Risikomanagement ist kein Kostenfaktor, sondern eine Investition in die Überlebensfähigkeit und Resilienz des Unternehmens.
Wie geht man am besten vor? Ganz einfach:
1. Risiken identifizieren: Man setzt sich mit seinem Team zusammen und überlegt, was dem Unternehmen alles zustossen könnte. Das Team darf gross und unterschiedlich zusammengesetzt sein. Seien Sie ruhig kreativ - auch das unwahrscheinlichste Szenario sollte bedacht werden. Es geht darum, möglichst viele Risiken zu erkennen.
2. Risiken Bewerten: Wie wahrscheinlich ist jedes Risiko? Und wie gross wäre der Schaden? Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadenhöhe – diese beiden Faktoren bestimmen die Relevanz eines Risikos. Je grösser die Kombination, desto gewichtiger das Risiko. Für die Beurteilung setzen wir auf interaktive, webbasierte Tools. Die gegenseitige Beeinflussung der Teilnehmer kann mit diesen praktisch ausgeschlossen werden. Die Ergebnisse lassen sich sofort visualisieren. Und das Beste: Die Teilnehmer müssen nicht zwingend vor Ort präsent sein.
3. Massnahmen planen: Welche Risiken sind so bedrohlich, dass sie unbedingt vermieden werden müssen? (Beispiel: Konsequenter Ausschluss bestimmter
Geschäftsfelder). Welche können abgeschwächt werden, z.B. durch Diversifizierung der Lieferanten oder die Entwicklung von Notfallplänen? Welche Risiken können an andere abgegeben werden, etwa durch eine Versicherung? Und welche sind so gering, dass man sie selbst tragen kann?
4. Überprüfen: Risiken ändern sich. Überprüfen Sie Risiken und Massnahmen regelmässig und passen Sie sie bei Bedarf an. Kunden von uns habe gar Risk Owner definiert, die für die permanente Überwachung bestimmter Risiken zuständig sind.
In unsicheren Zeiten ist Risikomanagement nicht nur eine kluge Vorsichtsmassnahme, sondern eine Überlebensstrategie. Warten Sie nicht, bis der Sturm Ihr Unternehmen ins Wanken bringt. Investieren Sie jetzt in die Sicherheit Ihres Unternehmens. Es wird sich auszahlen, selbst wenn die Sonne scheint. Denn der nächste Sturm kommt bestimmt. Die Frage ist nur: Wie gut sind Sie vorbereitet?
Bleiben Sie sicher und erfolgreich!
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Unternehmensanalyse oder der Blick nach innen (November 2024)
4. Teil der Strategiereihe
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Arjen Robben war einer der besten Fussballer seiner Generation. Er war ein ausgesprochener Linksfuss. Böse Zungen behaupteten, er brauche sein rechtes Bein nur, um das Gleichgewicht zu halten. Alle seine Gegenspieler wussten, dass er von rechts kommend nach innen ziehen würde, um dann links abzuschliessen. Doch ein ums andere Mal gelang es ihm, sie mit einer kleinen Körpertäuschung zu überlisten und Tore zu erzielen.
Es ist immer wieder faszinierend, wie gut Spitzensportler ihre Stärken und Schwächen kennen und wie souverän sie dieses Wissen nutzen. Stärken werden konsequent ausgebaut und ausgespielt, Schwächen eliminiert, reduziert oder umgangen - ein Ansatz, der sich auch auf Unternehmen übertragen lässt.
Der vierte Teil der Serie zur Strategieentwicklung befasst sich mit der Unternehmensanalyse (rot in der Grafik unten). Sie dient dazu, die Stärken und Schwächen des Unternehmens zu identifizieren.
Strategieentwicklungsprozess
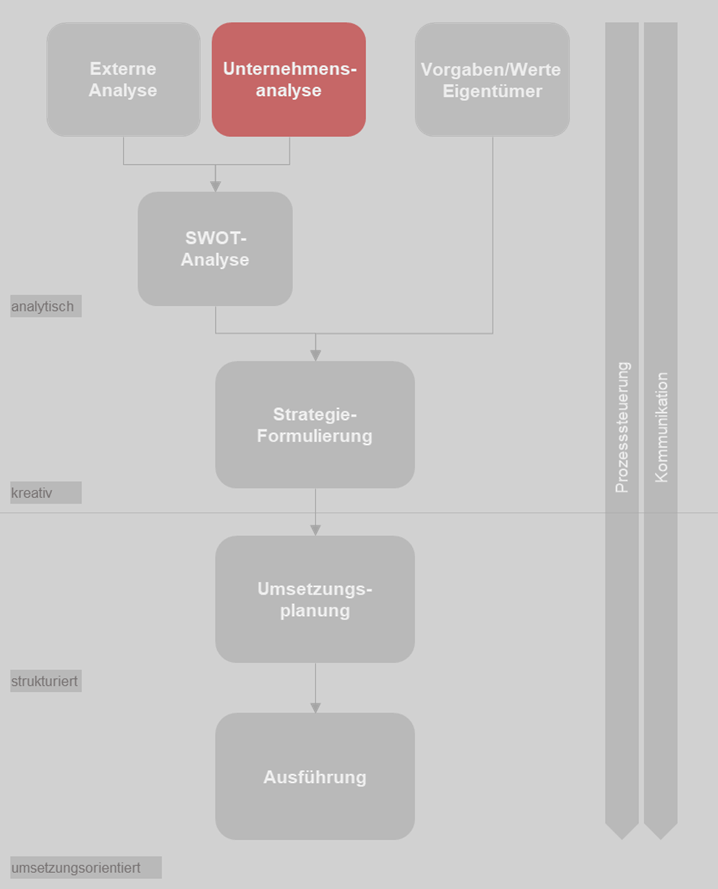
Im Gegensatz zu den äusseren Einflüssen, die im letzten Teil dieser Serie behandelt wurden, können Unternehmen ihre Stärken und Schwächen selbst beeinflussen. Umso wichtiger ist es, die Analyse sorgfältig und unvoreingenommen durchzuführen.
Dazu müssen im Wesentlichen folgende Fragen beantwortet werden:
- Was soll untersucht werden? Welche Bereiche, Funktionen, Prozesse, Instrumente?
- Wie soll das geschehen? Mit welchen Mitteln und Methoden?
- Wer wird einbezogen? Management, Mitarbeiter, Kunden, weitere?
- Aufgrund welcher Kriterien sollen die analysierten Bereiche beurteilt werden?
Was in welcher Tiefe untersucht wird, hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Während bei einem Kaffeemaschinenhersteller die Produktionsabläufe ein grosses Gewicht haben, sind es bei einem Detailhändler die Standorte. Was jedoch nie fehlen darf, ist eine Analyse des Leistungsangebots.
Mögliche Analysebereiche
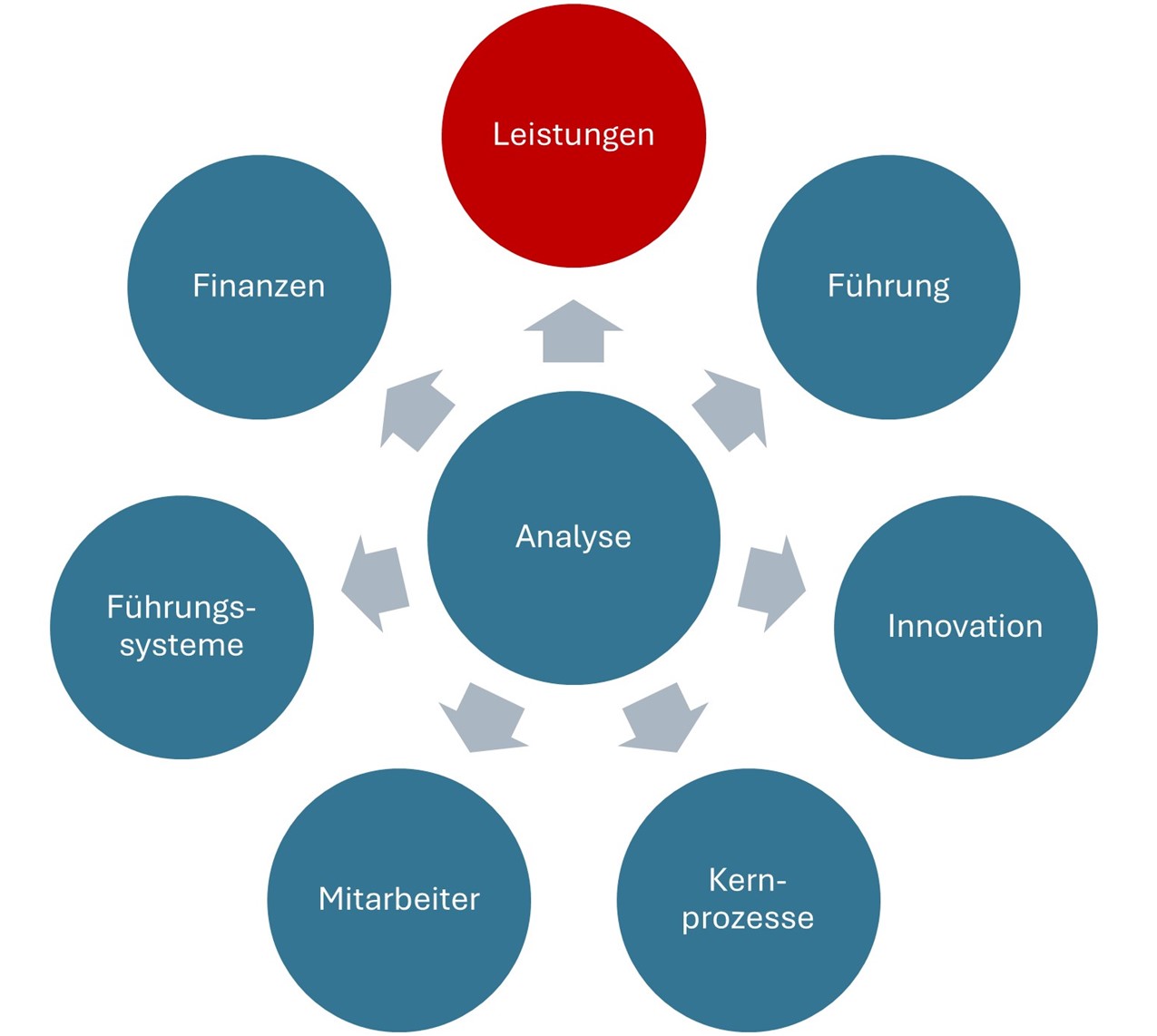
Zur Gewinnung der notwendigen Informationen bieten sich Auswertungen von Daten aus dem Unternehmen sowie aus externen Quellen, Workshops oder Interviews mit Mitarbeitern und Kunden an.
Wir empfehlen, Kunden wenn immer möglich miteinzubeziehen. Sie haben einen Blick von aussen, was gegen Betriebsblindheit schützt. Zudem spiegeln sie die Wahrnehmung des Marktes und verhelfen zu wichtigen Erkenntnissen darüber, wie die eigenen Leistungen im Vergleich zur Konkurrenz gesehen werden.
Woran soll sich bei der Unternehmensanalyse die Bewertung einer bestimmten Eigenschaft orientieren? Ohne Kontext lassen sich gegebene Eigenschaften nicht einordnen. Ist es beispielsweise ein Vorteil, viele hochqualifizierte und entsprechend gutbezahlte Finanzmathematiker in seinen Reihen zu wissen? Ein Hedgefonds wird diese Frage zweifellos anders beantworten als ein Lebensmitteldiscounter.
Die Stärken und Schwächen eines Unternehmens lassen sich anhand zweier Massstäbe herausschälen: Den Marktanforderungen und dem Konkurrenzvergleich. Aufgrund der Marktanforderungen lässt sich beurteilen, wie gut die analysierten Eigenschaften die Geschäftstätigkeit unterstützen oder ob sie für diese gar hinderlich sind. Mit Hilfe des Konkurrenzvergleichs lässt sich ermitteln, wo ein Unternehmen besser oder schlechter aufgestellt ist als seine Mitbewerber.
Wie wichtig Kontext ist, veranschaulicht wiederum ein Beispiel aus dem Sport sehr schön.
Armand Duplantis ist derzeit der beste Stabhochspringer der Welt. Er hält mit 6,25 Metern den Weltrekord in dieser Disziplin. Duplantis ist auch ein unglaublich schneller Läufer. Die 100 Meter legt er in 10,37 Sekunden zurück. Bei den Sprintern hätte er damit allerdings keine Chance. Da er diese Eigenschaft aber in seiner Disziplin hervorragend einsetzt, ist sie ein Trumpf, der ihn der Konkurrenz überlegen macht.
Im nächsten Newsletter dieser Reihe werden wir darlegen, wie mittels Verbindung von Unternehmensanalyse und externer Analyse systematisch Chancen und Gefahren herausgearbeitet werden können.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
In der Serie zum Thema Strategie bisher erschienen:
-
Wer braucht schon eine Strategie? (Oktober 2022)
-
Strategieprozess (Juni 2023)
-
Externe Analyse oder der Blick nach aussen (Januar 2024)
Kontrollen, die das Vertrauen stärken (Juli 2024)
Vom Nutzen eines internen Kontrollsystems
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Vor einigen Jahren musste ich mich einer geplanten Schulteroperation unterziehen.
Kurz vor dem Krankenhausaufenthalt wurde ich angewiesen, das Operationsgebiet mit einem wasserfesten Stift zu markieren. In meinem Fall war es die linke Schulter. Beim Eintritt wurde ich nach meiner Identität gefragt, musste die geplante Operation nennen und meine Markierung zeigen. Auf dem Weg zum Operationssaal und der Übergabe an die Anästhesie wurden mir dieselben Fragen abermals gestellt.
All diese Kontrollen sind Teil der "Checkliste Sichere Chirurgie", an die sich das Krankenhaus hält. Sie stellt sicher, dass der richtige Patient, an der richtigen Stelle, für die richtige Diagnose, vom richtigen Team, im richtigen Operationssaal operiert wird. Zusammen mit vielen anderen Massnahmen trägt sie dazu bei, Verwechslungen und andere Fehler zu vermeiden, die für Patienten schwerwiegende Folgen haben können.
Im Gegensatz zu Spitälern geht es in den meisten Unternehmen glücklicherweise nicht ständig um Leben und Tod oder die Gesundheit von Menschen. Dennoch sind auch sie in ihren Prozessen mit möglichen Fehlerquellen konfrontiert, die gravierende Auswirkungen auf Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten, Eigentümer oder Kapitalgeber haben können.
Schäden können beispielsweise durch nicht abgerechnete Leistungen, unsachgemäss ausgeführte Arbeiten, nicht sorgfältig ausgewählte Lieferanten, Vernachlässigung von Sicherheitsvorschriften, doppelte Bezahlung von Lieferantenrechnungen oder gar Delikte entstehen.
Diese kurze Aufzählung zeigt, wie vielfältig und unterschiedlich solche Risiken sind.
Um diese Risiken zu vermeiden und Fehlerquellen frühzeitig aufzudecken, müssen massgeschneiderte Vorkehrungen ergriffen und geeignete Instrumente eingesetzt werden. Das kann ein Vieraugenprinzip bei der Vergabe grösserer Aufträge sein, die Trennung von Ausführungs- und Kontrollfunktion bei kritischen Tätigkeiten oder eine Checkliste bei der Prüfung von Lieferantenrechnungen.
Die Summe dieser Massnahmen wird als Internes Kontrollsystem (IKS) bezeichnet.
Viele Unternehmen, auch KMUs, verfügen bereits über gewisse Kontrollen in ihren Abläufen. Trotzdem sollten auch sie, über die Einrichtung eines umfassenden IKS nachdenken. Für die meisten dürfte es in einem ersten Schritt darum gehen, zunächst alle bislang getroffenen Massnahmen zu erfassen, allfällige Mängel zu beheben und Lücken zu schliessen.
Dabei ist es ratsam, sich an den konkreten unternehmensspezifischen Gegebenheiten zu orientieren und sich auf das Wesentliche zu beschränken. Nichts wäre kontraproduktiver als dieser Herausforderung mit einer Standardlösung zu begegnen oder ein Bürokratiemonster zu erschaffen.
Es gibt unterschiedliche Wege, ans Ziel zu gelangen. Ein möglicher und von uns bevorzugter Ansatz ist, sich zunächst grundsätzlich Gedanken darüber zu machen, welchen Risiken das Unternehmen ausgesetzt ist und diese dann auf ein IKS herunterzubrechen.
Der Begriff "Internes Kontrollsystem" weckt ungute Assoziationen. Er könnte direkt aus George Orwells "1984" stammen und hätte nicht schlechter gewählt werden können. Man denkt an permanente Überwachung und Bevormundung. Dabei geht es genau um das Gegenteil: Das Verhindern oder frühzeitige Aufdecken von gravierenden Fehlern schafft Vertrauen und gibt Sicherheit.
Für mich jedenfalls hatten die Checks vor meiner Schulteroperation etwas sehr Beruhigendes.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Externe Analyse oder der Blick nach aussen (Januar 2024)
3. Teil der Strategiereihe
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Externe Faktoren haben nicht selten einen entscheidenden Einfluss auf das Schicksal eines Unternehmens.
Ohne Corona gäbe es Twint heute vermutlich nicht mehr. Erst die Pandemie hat der Bezahlapp zum Durchbruch verholfen. Die zunehmende Digitalisierung wurde Kodak zum Verhängnis. Der einstige Platzhirsch der analogen Fotografie verpasste diese Entwicklung und ist nach einem Insolvenzverfahren heute nur noch ein Schatten seiner selbst.
Ist unternehmerischer Erfolg also nur eine Frage des Glücks?
Nicht ganz.
In diesem dritten Teil der Reihe über Strategie geht es um die externe Analyse im Rahmen des Strategieentwicklungsprozesses (rot in untenstehender Grafik), der im vorangehenden Teil der Serie im Juni letzten Jahres vorgestellt wurde.
Strategieentwicklungsprozess
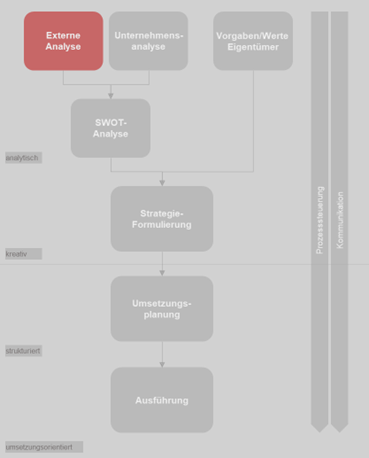
Natürlich kann man nicht alles vorhersehen, was in der Welt passiert. Plötzliche, unvorhersehbare oder sehr unwahrscheinliche Ereignisse mit grossen Auswirkungen wie ein Erdbeben oder eben Corona könnten vielleicht als abstrakte Formen einer Gefahr erkannt werden, die konkreten Folgen entziehen sich aber unserem Vorstellungsvermögen. Man kann jedoch versuchen, langfristige Trends und Entwicklungen zu identifizieren, welche einen erheblichen Einfluss auf das Unternehmen haben könnten.
Dazu werden häufig folgende zwei Tools verwendet: Die Branchenanalyse von Porter und die PESTEL-Analyse.
Die Branchenanalyse von Porter befasst sich mit dem Markt, in welchem das Unternehmen tätig ist, und den Kräften, die dort wirken (siehe Bild unten).
Fünf-Kräfte-Modell von Porter

Quelle: https://www.mindtools.com/at7k8my/porter-s-five-forces
Mit ihr lassen sich die Dynamiken des relevanten Marktes systematisch erfassen und beurteilen.
Manche Unternehmen konzentrieren sich dabei zu sehr auf ihre direkten Konkurrenten und glauben, diese in einem Preiskampf schlagen zu müssen, statt auf die eigenen Qualitäten zu setzen. Dabei vernachlässigen sie die Bedürfnisse der Kunden und vergessen, dass diese oft eine weitaus differenziertere Wahrnehmung unterschiedlicher Angebote haben, als nur auf den Preis zu schauen. Ausserdem werden andere potenzielle Bedrohungen aber auch sich bietenden Chancen gerne überersehen.
Die PESTEL-Analyse ist in Ergänzung zu Porter ein bewährtes Raster, um die weitere Umwelt über den unmittelbaren Markt hinaus zu untersuchen. Sie unterteilt diese in eine politische (Political), ökonomische (Economical), sozio-kulturelle (Social), technische (Technological), ökologische (Environmental) und rechtliche (Legal) Umwelt.
Pestel-Raster

Quelle: https://springworks.ch/en/pestel-analysis/
Beispiele für solche Entwicklungen können je nach Unternehmen die bereits erwähnte Digitalisierung, die Überalterung der Bevölkerung in der Schweiz, der Siegeszug der KI, der fortschreitende Klimawandel oder steigende Zinsen sein.
Dabei sollten Trends nicht vorschnell als Chance oder Gefahr qualifiziert werden. Das ist erst unter Einbezug der Stärken und Schwächen eines Unternehmens möglich. Erst wenn ein Trend auf eine eigene Stärke trifft, ergibt sich für das Unternehmen eine Chance.
Trotz grösster Sorgfalt können im Rahmen einer externen Analyse weder alle relevanten Entwicklungen vorhergesehen noch quantifiziert werden. Die Konsequenz ist aber nicht ein Verzicht auf dieses Instrument, sondern das Erstellen verschiedener Szenarien und das Entwickeln entsprechender Handlungsoptionen. "Prepare, don't predict" lautet das Motto.
Und wie kann man sich gegen Schocks, also plötzlich auftretende, heftige Veränderungen wappnen? Diese entziehen sich ja per Definition einer externen Analyse. Hier hilft ein robustes Geschäftsmodell, das stärkere Turbulenzen aushalten kann und in unterschiedlichen Situationen funktioniert. Solche Geschäftsmodelle können Redundanzen beinhalten, kürzere Lieferwege, eine höhere Liquidität oder eine Inhouse-Produktion. Weil dies aber mit höheren Kosten verbunden sind, werfen sie tiefere (Jahres-)Gewinne ab. Dafür werden diese längerfristig gesichert.
Trotz des Versuchs, externe Faktoren bei der Entwicklung der Unternehmensstrategie weitestgehend zu berücksichtigen, braucht es für den unternehmerischen Erfolg immer auch noch Glück. Aber wie der römische Philosoph Seneca schon gesagt haben soll:
Glück ist, was passiert, wenn Vorbereitung auf Gelegenheit trifft.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
In der Serie zum Thema Strategie bisher erschienen:
-
Wer braucht schon eine Strategie? (Oktober 2022)
-
Strategieprozess (Juni 2023)
Kein Platz für Belästigungen (November 2023)
Sexuelle Belästigungen am Arbeitsplatz verhindern
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Die spanische Fussballerin Jennifer Hermoso wurde bei der WM-Siegerehrung am 20. August in Sidney vor den Augen der sportinteressierten Weltöffentlichkeit vom Chef des spanischen Fussballverbandes, Luis Rubiales, gegen ihren Willen auf den Mund geküsst. Es folgte ein Trauerspiel, in welchem Rubiales sich aus der Verantwortung zu stehlen versuchte. Erst als der öffentliche Druck keine andere Wahl mehr liess, trat er schliesslich zurück.
Auch der spanische Fussballverband machte dabei eine schlechte Figur. Jener hatte zunächst noch reflexartig den Verbandschef gestützt, statt sich schützend vor die Spielerin zu stellen.
Eine von der Bischofskonferenz in Auftrag gegebene Vorstudie zu sexuellem Missbrauch im Umfeld der katholischen Kirche in der Schweiz brachte im September 2023 über 1000 Fälle an den Tag.
Die Kirche hatte gemeldete Fälle lange Zeit verschwiegen, vertuscht oder bagatellisiert. Beschuldigte Priester waren einfach in eine andere Gemeinde versetzt worden. Die Opfer wurden allein gelassen.
Es handelt sich hierbei um spektakuläre Fälle, welche von den Medien aufgegriffen wurden. Sie zeigen neben individuellen Fehlleistungen insbesondere auch ein Versagen von Institutionen wie dem spanischen Fussballverband oder der katholischen Kirche.
Wie sieht es aber in Ihrem Unternehmen aus? Was wird unternommen, um sexuellen Belästigungen oder gar Übergriffen zuvorzukommen? Und was ist vorgesehen, wenn doch einmal etwas geschieht? Welche Meldemöglichkeiten gibt es? Sind Abläufe und mögliche Sanktionen definiert und bekannt? Wie werden Betroffene geschützt?
Das sind keine Fragen aus der Woke-Ecke. Viele sind sich dessen nicht bewusst, aber der Schutz vor sexueller Belästigung ist ein Recht aller Arbeitnehmenden, so wie die Unfallverhütung oder der Gesundheitsschutz.
Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz verletzt die persönliche Integrität und gilt als eine Form der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts. Ob eine solche vorliegt, hängt im Wesentlichen von empfinden der Betroffenen ab und nicht von der Absicht der handelnden Personen. Sexuelle Belästigung kann verschiedene Formen annehmen:
- Anzügliche und zweideutige Bemerkungen über das Äussere
- Sexistische Bemerkungen oder "Witze" über sexuelle Merkmale, sexuelles Verhalten oder die sexuelle Orientierung
- Vorzeigen, Aufhängen, Auflegen und Verschicken von pornografischem Material
- Unerwünschte Einladungen mit eindeutiger Absicht
- Unerwünschten Körperkontakte
- Sexuellen Übergriffe, Nötigung oder Vergewaltigung
Arbeitgeber haben die Pflicht, die erforderlichen Massnahmen zum Schutz der persönlichen Integrität Arbeitnehmender zu ergreifen. Im Streitfall können Arbeitgeber haftbar gemacht werden, wenn sie dieser nicht nachgekommen sind.
Zu den Präventionsmassnahmen gehören:
- Klare Politik des Nicht-Duldens von sexueller Belästigung im Betrieb (Grundsätze, Null-Toleranz)
- Sensibilisierung und Information der Mitarbeitenden für das Thema
- Ausbildung der Führungskräfte zur Erkennung und Vermeidung von sexuellen Belästigungen
- Bezeichnung von internen oder externen vertraulichen Anlaufstellen für die Betroffenen
- Klar definierte und transparente Vorgehensweise im Fall von sexueller Belästigung
- Bezeichnung von möglichen Konsequenzen bei sexueller Belästigung
Damit sich in Ihrem Unternehmen kein Fall Rubiales abspielen kann, braucht es lediglich guten Willen und ein überschaubares Set an Massnahmen, das sich ohne grossen Aufwand umsetzen lässt.
Mitarbeitende, die wissen, dass es in Ihrem Unternehmen keinen Platz für sexuelle Belästigung gibt, werden es mit Motivation und Treue danken.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Weiterführende Informationen und Merkblätter finden Sie hier: https://www.ebg.admin.ch/ebg/de/home/themen/arbeit/sexuelle-belaestigung-am-arbeitsplatz/praevention-im-unternehmen.html
Eine Übersicht der relevanten gesetzlichen Bestimmungen finden Sie hier:
https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Arbeit/Arbeitsbedingungen/gesundheitsschutz-am-arbeitsplatz/Psychosoziale-Risiken-am-Arbeitsplatz/Sexuelle-Belaestigung.html
Strategieprozess (Juni 2023)
2. Teil der Strategiereihe
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Im zweiten Teil unserer Serie zum Thema Strategie konzentrieren wir uns auf den systematischen Strategieentwicklungs- und Strategieumsetzungsprozess. Ja, es gibt auch andere Wege zu einer erfolgreichen Strategie. Nachfolgende Grafik veranschaulicht einen möglichen Ablauf mit dem Ziel einen ersten Überblick zu vermitteln.
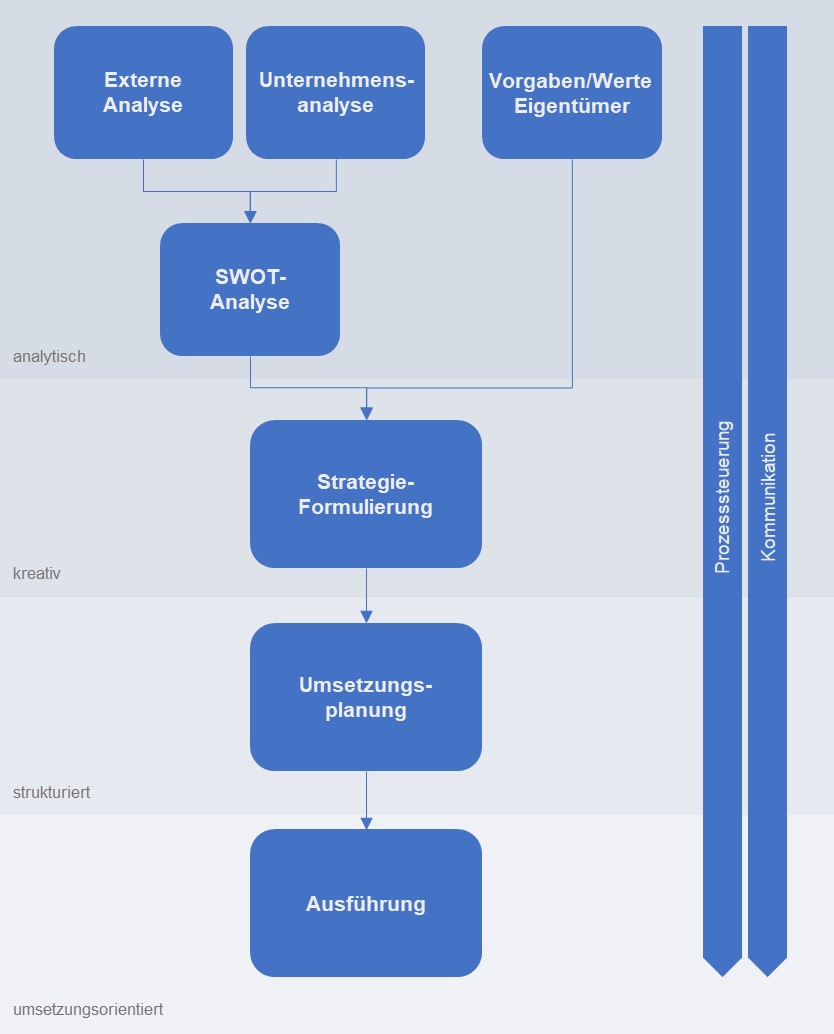
Im analytischen Teil des Prozesses werden die Grundlagen für die Strategieformulierung erarbeitet. Es geht dabei ums Verstehen.
Die Umweltanalyse befasst sich mit äusseren Faktoren, die einen Einfluss auf das Unternehmen haben. Sie versucht Fragen zu beantworten wie: Was passiert um uns herum, das für uns relevant ist? Welche Trends zeichnen sich ab? Inwiefern könnten diese fürs Unternehmen wichtig werden?
Die Unternehmensanalyse schält die Stärken und Schwächen des Unternehmens heraus. Das geschieht einerseits, indem man versucht herauszufinden, wie die Kunden das Unternehmen sehen und sich andererseits mit Konkurrenten vergleicht.
In der SWOT-Analyse (SWOT für Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threads), werden die wichtigen Entwicklungen in der Unternehmensumwelt den Stärken und Schwächen des Unternehmens gegenübergestellt. Dies mit dem Ziel, künftige Chancen und Gefahren zu erkennen und erste Ideen für Strategien abzuleiten (Beispiel: Wie können wir auf der Basis unserer Stärken eine Chance nutzen?).
Die Vorgaben der Eigentümer sind das letzte Element dieser Phase, aber gerade in KMUs häufig ein zentrales. Sie beruhen auf den Wertvorstellungen der Eigentümer und grenzen bewusst den Spielraum bei der Definition der Strategie ein. Darin kann es beispielsweise heissen, dass man sich grundsätzlich selbst finanziert oder dass man ausschliesslich in der Schweiz produziert.
Die Entwicklung und Formulierung der Strategie ist der kreative Teil des Prozesses. Auf Basis der vorangegangenen Analysen werden Zukunftsbilder und Szenarien sowie strategische Optionen und Stossrichtungen entworfen und beurteilt. Am Ende steht der Entscheid darüber, welche Ziele man auf welchem Weg mit welchen Mitteln verfolgen will, also wie die Strategie aussieht.
Im nächsten Schritt folgt die konkrete Umsetzungsplanung. Jetzt ist strukturiertes Denken gefragt. Die einzelnen Massnahmen, die notwendigen Ressourcen und die zu erreichenden Etappenziele konkretisiert und in einem Finanzplan abgebildet. Dabei erfolgt typischerweise auch die Überprüfung der Machbarkeit und die Simulation möglicher Szenarien.
Schliesslich muss die Strategie auch tatsächlich umgesetzt werden. Persönliche Führung mit intensiver Kommunikation und glaubwürdigem Vorleben seitens der Unternehmensleitung sind nun gefordert, kurz Leadership. Während der Ausführung müssen Schwierigkeiten gemeistert, Ängste und Widerstände überwunden und Rückschläge verkraftet werden. Unter Umständen müssen sogar Ziele angepasst werden. Geduld, Frustrationsresistenz und Durchhaltewillen sind hierbei nützliche Eigenschaften.
Die Prozesssteuerung achtet darauf, dass jeweils die richtigen Personen miteinbezogen werden, die Pace gehalten, die einzelnen Schritte möglichst sorgfältig durchgeführt werden und nichts vergessen geht. Der lineare Ablauf in obiger Darstellung ist dem besseren Verständnis des Prozesses geschuldet. In der Realität verläuft dieser aber meist in Schlaufen, die einzelnen Schritte werden zum Teil mehrfach wiederholt.
Der Kommunikation kommt im Strategieprozess eine herausragende Bedeutung zu. Darum stellen wir sie immer mit einem separaten Strahl dar, welche den ganzen Prozess begleitet. Wer sie in all ihren Dimensionen begreift und lebt, hat die besten Chancen, eine erfolgreiche Strategie zu entwickeln und umzusetzen.
Jede einzelne Komponente in diesem Ablauf erfüllt bestimmte Aufgaben. Wie und mit welchen Werkzeugen diese Aufgaben am besten gemeistert werden können, werden wir in den kommenden Newsletters zu dieser Serie erläutern.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
In der Serie zum Thema Strategie bisher erschienen:
- Wer braucht schon eine Strategie? (Oktober 2022)
Zu gut um wahr zu sein (Januar 2023)
Betrügern nicht auf den Leim gehen
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Im Dezember letzten Jahres begann der Prozess im Wirecard-Skandal, dem vermutlich grössten Betrugsfall in der neueren deutschen Geschichte.
Einen Monat zuvor war in den USA die Theranos-Gründerin Elizabeth Holmes wegen Betrugs zu über 11 Jahren Gefängnis verurteilt worden.
Wirecard und Theranos, die einstigen Highflyer, sind insolvent beziehungsweise bereits liquidiert. Bei beiden Unternehmen gab es Warnsignale. Sie wurden ignoriert. Zu schön war der kometenhafte Aufstieg dieser vermeintlichen Unicorns, zu verlockend der Ritt auf deren Erfolgswelle. Grosse und kleine Anleger, Banken und andere Geschäftspartner erlitten herbe Verluste.
Die Angst, eine einmalige Chance zu verpassen, versuchen auch Betrüger zu nutzen, die es auf KMUs abgesehen haben.
Hierzu zwei glimpflich verlaufene Beispiele:
Im ersten Fall erhielt eine von uns beratene Firma, nennen wir sie der Einfachheit halber Ziel AG, ein Mail von einer englischen Finanzboutique.
Darin hiess es, ein grosses Unternehmen aus einem Nachbarland sei auf die Ziel AG und deren hervorragenden Positionierung in der Schweiz aufmerksam geworden. Im Rahmen seiner europäischen Expansionsstrategie sei dieses Unternehmen an einer Übernahme interessiert und habe die Finanzboutique beauftragt, eine allfällige Transaktion vorzubereiten und durchzuführen. Um den Prozess zu beschleunigen, solle man doch schon mal die eigenen Preisvorstellungen nennen.
Augen begannen zu leuchten, Pläne wurden geschmiedet. Die Geschäftsleitung der Ziel AG fühlte sich durch diese Worte bestätigt und geschmeichelt, während die Unternehmerfamilie die Chance sah, ein schwelendes Nachfolgeproblem zu lösen und dabei Teil einer spannenden Wachstumsstrategie zu werden.
Doch bald meldeten sich erste Zweifel. Dies war nicht die Art und Weise, Geschäfte dieser Grössenordnung abzuwickeln. Besser ein paar Recherchen machen.
Schnell stellte sich heraus, dass die Vermittlerfirma gar nicht existierte. Der seriös wirkende Internetauftritt war ein Fake. Dort aufgeführte Personen waren im Netz nicht auffindbar. Ebenso erwies sich die Adresse des Firmensitzes als falsch. Als wir nachfragten, wurde der Kontakt sofort abgebrochen.
Vermutlich waren die Betrüger darauf aus, im Verlauf des Prozesses Vorschüsse und Gebühren zu ergaunern. Wir werden es nie herausfinden.
Im zweiten Fall meldete sich jemand telefonisch bei einem von uns betreuten Industrieunternehmen. Der Anrufer gab an, im Auftrag eines bekannten internationalen Konzerns zu handeln und behauptete, rund hundert Maschinen des Industrieunternehmens kaufen zu wollen.
Wenn das keine Chance war! Volumen, Umsatz und die Möglichkeit, in eine höhere Liga aufzusteigen, liessen den Puls höher schlagen. Normalerweise umfasst eine Transaktion nur wenige Maschinen.
Sicher ist sicher, sagten sich die Verantwortlichen dennoch und fragten beim besagten internationalen Konzern nach. Hatte dieser tatsächlich jemanden mit dem Kauf der Maschinen beauftragt? Wenig überraschend war weder der vermeintliche Vermittler bekannt, noch wusste man von einem solchen Auftrag.
Auf die Unstimmigkeiten aufmerksam gemacht, brach der Anrufer auch in diesem Fall den Kontakt sofort ab.
Hier handelte es sich wahrscheinlich um den Versuch, die Maschinen liefern zu lassen, um dann ohne Bezahlung damit zu verschwinden. Der Verlust hätte schwer gewogen.
Fazit: Klingt eine Geschichte zu gut, um wahr zu sein, dann ist sie es meist nicht. Eine gesunde Portion Vorsicht kann vor grossen Schäden bewahren.
Bonustipp: Ahmen die Protagonisten Steve Jobs nach und tauchen in schwarzen Rollkragenpullovern auf, sollten Sie in jedem Fall unverzüglich das Weite suchen.
In diesem Sinne, bleiben Sie auf der Hut.

Bildquellen:
https://www.vanityfair.com/news/2016/09/elizabeth-holmes-theranos-exclusive
https://www.spiegel.de/wirtschaft/ist-wirecard-chef-markus-braun-ein-betrueger-a-00000000-0002-0001-0000-000167380447
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Wer braucht schon eine Strategie? (Oktober 2022)
Über den Nutzen einer Strategie
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Das Thema Strategie ist aktuell in den Medien so präsent wie schon lange nicht mehr.
Die Credit Suisse arbeitet intensiv an einer neuen Strategie. Man spricht von einem grossen Umbau. Die vielen verlustreichen Rückschläge der letzten Jahre lassen keine andere Wahl. Ebenso hat der Sulzer-Konzern angesichts grosser Veränderungen in seinen Stammmärkten eine Überprüfung seiner bisherigen Strategie angekündigt.
Aber was ist überhaupt eine Strategie?
Eine Strategie legt die langfristige Ausrichtung (drei bis fünf Jahre) eines Unternehmens fest. Zu einer Strategie gehören drei fundamentale Dimensionen, die anhand einer Reihe von Fragen definiert werden:
1. Das Ziel
Wohin soll die Reise gehen? Wo möchte man in Zukunft stehen?
Wie soll das Unternehmen künftig aussehen? Was soll konkret erreicht werden?
2. Der Weg
Wie kommt man dahin? Welche Schritte, Massnahmen und Mittel führen zu den gesteckten Zielen?
3. Die Zeit
Bis wann sollen die Ziele erreicht werden? Wann gilt es, wichtige Zwischenetappen zu erreichen? .
Und was bringt eine Strategie?
Mit einer Strategie soll die Entwicklung oder das Wachstum eines Unternehmens oder, wie im Falle der Credit Suisse, dessen Fortbestand sichergestellt werden. Dafür ist sie der Plan.
Ressourcen sind in jedem Unternehmen nur beschränkt verfügbar. Mit Hilfe einer Strategie sollen diese gezielt und effizient eingesetzt werden, während gleichzeitig das Risiko von Fehlentscheidungen möglichst klein gehalten werden soll.
Durch ihren vorausschauenden Charakter schafft eine Strategie Handlungsspielräume. Selbst unvorhergesehene Ereignisse lassen sich dadurch besser bewältigen. Kurz: man ist vorbereitet.
Je grösser und komplexer ein Unternehmen wird, desto anspruchsvoller gestaltet sich die Koordination der Kräfte. Eine nachvollziehbare und verständlich kommunizierte Strategie kann dafür sorgen, dass alle am gleichen Strick ziehen.
Dabei bieten sich zusätzliche Chancen: Können sinnstiftende Ziele mit einem gesellschaftlichen Nutzen formuliert werden, wie z.B. die Reduktion des CO2-Ausstosses auf netto Null, wirken diese motivierend auf die Mitarbeiter und erhöhen die Attraktivität des Unternehmens auf dem Arbeitsmarkt.
Ist eine Strategie nur etwas für grosse Unternehmen?
Das Gegenteil ist der Fall. Viele KMU verdanken ihren Erfolg einer guten Strategie. Kleinere Unternehmen verfügen über wesentlich begrenztere finanzielle Mittel als grosse und haben weniger Möglichkeiten Geld aufzunehmen. Sie dürfen sich nicht zu viele und vor allem keine kostspieligen Fehler erlauben. Daher sind eine klare Ausrichtung und darauf basierende Investitionen umso wichtiger.
Die Credit Suisse und Sulzer erhalten aufgrund ihrer Grösse und Geschäftstätigkeit mediale Aufmerksamkeit. Diese beleuchtet jedoch ein Thema, mit dem sich jedes Unternehmen befassen sollte.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
PS Aufgrund seiner Bedeutung werden wir dem Thema Strategie in loser Folge weitere Newsletter folgen lassen. Wir werden uns dabei unter anderem dem eigentlichen Strategieprozess, der Rolle der Kommunikation oder den Hürden bei der Umsetzung widmen.
Was ist das Problem? (Mai 2022)
Die Bedeutung einer sorgfältigen Problemanalyse
Liebe Kunden, Partner und Freunde
"Wenn ich eine Stunde Zeit hätte, um ein Problem zu lösen, würde ich 55 Minuten damit verbringen, über das Problem nachzudenken und fünf Minuten über die Lösung."
Albert Einstein, aber wahrscheinlich nicht *
Weise Worte. Im unternehmerischen Alltag ist jedoch häufig das Gegenteil zu beobachten. Es werden rasch Lösungen entwickelt und Entscheide gefällt, ohne das zugrunde liegende Problem wirklich zu verstehen.
Das rächt sich insbesondere dann, wenn es sich um komplexe Fragestellungen handelt, die nicht als solche erkannt werden und Quick Fixes gegenüber vertieften Analysen der Vorzug gegeben wird.
Denn komplexe Probleme werden durch Quick Fixes nicht gelöst. Die Folge ist vielmehr, dass man sich erneut mit ihnen auseinandersetzen muss. Die vermeintliche Abkürzung verschlingt weit mehr Zeit und Ressourcen als der Weg über eine saubere Problemanalyse.
Ein Beispiel hierzu:
Die Firma OMG stellt Waschmaschinen für den gewerblichen und industriellen Gebrauch her. Das Geschäft läuft gut, bis eines Tages ein Umsatzrückgang zu verzeichnen ist.
Die Geschäftsleitung tagt. Dabei stellt sie fest, dass das Werbebudget in den letzten Jahren gekürzt wurde. Reflexartig beschliesst sie, eine umfassende Werbekampagne zu lancieren, um den Absatz wieder anzukurbeln.
Ein halbes Jahr später zeigt sich: die Kampagne blieb wirkungslos. Der Umsatz geht weiter zurück.
Die Geschäftsleitung tagt erneut. Anekdotische Berichte deuten darauf hin, dass die Produkte der OMG als zu teuer wahrgenommen werden. Also beschliesst die Geschäftsleitung eine Preissenkungsrunde.
Doch auch die hilft nicht. Nach sechs weiteren Monaten ist der Umsatz weiter geschrumpft.
Erst jetzt wird ein Team eingesetzt, das den tatsächlichen Ursachen für die Umsatzeinbussen auf den Grund gehen soll. Nach einer Kundenbefragung, einer Konkurrenzanalyse und Gesprächen mit der Serviceabteilung, die von häufigen Reparaturen berichtet, ergibt sich ein gänzlich neues Bild.
Seit einiger Zeit sind Mitbewerber der OMG mit besseren Maschinen auf dem Markt. Diese sind wartungsärmer und weniger reparaturanfällig. Zudem verbrauchen sie bedeutend weniger Wasser und Energie.
Diese Konkurrenzprodukte sind zwar teurer als die Geräte der OMG, für die Käufer ist der Anschaffungspreis jedoch nur ein Entscheidungsfaktor unter vielen. Für sie sind die Gesamtkosten des Betriebs (Total Cost of Ownership) und Zuverlässigkeit weitaus wichtiger.
Die Hauptursache für den Umsatzrückgang ist demnach eine Produktepalette, die nicht mit jener der Konkurrenz mithalten kann. Hier muss die OMG ansetzen, um wieder wettbewerbsfähig zu werden.
Im Nachhinein zeigt sich, dass zu eilig auf Lösungsversuche gesetzt wurde, statt dem Problem auf den Grund zu gehen. Zeit und Ressourcen, die dabei aufgewendet wurden, sind verloren, von den Umsatzeinbussen ganz zu schweigen.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
*Obwohl so im Netz zu finden, muss die Zurechnung des Zitats zu Albert Einstein wohl in Zweifel gezogen werden. Vgl. dazu https://quoteinvestigator.com/2014/05/22/solve/
Via Inhaberstrategie zur Nachfolgeregelung (Juli 2021)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Über 70'000 KMUs haben ihre Nachfolge noch nicht geregelt, obwohl die leitenden Personen sechzig oder älter sind. Das hat eine Studie von Bisnode D&B aus dem Jahr 2020 ergeben. Dabei scheint es sich um ein grundsätzliches Problem zu handeln.
Warum wird das Thema Nachfolgeregelung nicht proaktiv angegangen? Warum befasst man sich nicht damit, solange Zeit und Kraft noch im Überfluss vorhanden sind? Es liegt doch in der Natur von Unternehmern, sich Herausforderungen zu stellen.
Die Gründe dafür sind sicherlich vielfältig. Man wird vom Tagesgeschäft getrieben. Wichtige Investitionsentscheide fallen an. Neue Produkte werden lanciert. Die Arbeit von erkrankten Mitarbeitern muss übernommen werden. Die Liste könnte beliebig weitergeführt werden.
Der Widerwille, sich mit dem der eigenen Endlichkeit zu befassen, dürfte darüber hinaus eine gewichtige Rolle spielen. Ebenso der Gedanke, entbehrlich zu werden. Wer will sich schon mit dem Abbau seiner körperlichen und geistigen Kräfte befassen, bevor diese nachlassen? Wer will bereits ans eigene Ende denken, bevor es sich abzeichnet?
So trifft die Notwendigkeit, sich mit dem Thema der Nachfolge zu befassen auf eine verständliche Abneigung, genau dies zu tun. Und in der Regel gewinnt die Abneigung.
Das Erarbeiten einer Inhaberstrategie bietet hier einen eleganten Ausweg. Diese hält das Verhältnis der Eigentümer untereinander und zum Unternehmen fest. In ihr werden die Ziele und die Werte festgehalten, welche das Unternehmen aus Sicht der Eigentümer verfolgen und leben soll. Sie setzt die Leitplanken für die eigentliche Unternehmensstrategie.
Sie kann beispielsweise festhalten, ob Familienmitglieder ein Anrecht auf Einsitz in die Geschäftsleitung haben. Oder sie kann bestimmen, dass das Unternehmen finanziell unabhängig bleiben soll. Oder welche Lieferanten prioritär berücksichtigt werden sollen.
Eine umfassende Inhaberstrategie nimmt aber auch die Frage auf, wie die Eigentümer die Zukunft des Unternehmens sehen und welche Rolle sie selbst und Angehörige spielen werden.
Erfahrungsgemäss geht es an diesem Punkt darum, Perspektiven für sich, die eigene Familie, Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten zu entwickeln. Positiv besetzte Themen wie Werterhaltung und Wachstum, Stabilität und Agilität, Lebensqualität und Entscheidungsfreiheit dominieren. Die Frage der Nachfolge wird dabei häufig spielerisch und konstruktiv, quasi im Vorbeigehen geregelt.
Es gibt für KMUs viele gute Gründe, eine Inhaberstrategie festzulegen. Dass damit die Nachfolgeregelung frühzeitig, schmerzfrei und positiv angegangen werden kann, ist einer davon.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Brauchen wir eine neue Organisation? (März 2021)
Umgang mit neuen Organisationskonzepten
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Holzfällerhemden, Schlaghosen, Plateausohlen – plötzlich sind sie in. Alle wollen sie. Alle tragen sie.
Auch neue Organisationskonzepte erscheinen so regelmässig wie neue Modetrends. Sie warten mit knackigen und vielversprechenden Labels wie "Agile" oder "Holocracy" auf. Und mit der Botschaft, dass mit ihnen alles besser wird.
Dabei könnte man davon ausgehen, dass in über hundert Jahren Management- bzw. Organisationslehre alles schon einmal erdacht und kombiniert, beschrieben und ausprobiert, erforscht und beurteilt wurde: Hierarchie oder Selbstverwaltung, Zentralisation oder Dezentralisation, Formalisierung oder autonome Teams, um einige Beispiele zu nennen.

Quelle: Youtube, Stefan Kühl, Professor für Organisationssoziologie an der Universität Bielefeld, Folie aus einem Video zu einem Vortrag über Agilität New Work, 2018
(https://www.youtube.com/watch?v=QqN8ensY4xI&t=2019s)
Wenn sich eine Erkenntnis durchgesetzt hat, dann dass es die eine, für alle Unternehmen und alle Situationen beste Organisationsform schlicht nicht gibt.
Dennoch wäre es übereilt, alle neuen Konzepte von vornherein abzulehnen. Für die Beurteilung gilt es vielmehr, sich zunächst zwei grundlegende Dinge vor Augen zu führen:
Erstens ist Organisation eine Notwendigkeit, die von zunehmender Grösse und Arbeitsteilung getrieben wird. Je mehr Menschen zusammenarbeiten, desto mehr Prozesse müssen definiert und koordiniert, Verantwortlichkeiten und Entscheidungsbefugnisse festgelegt, Projekte geplant und geleitet werden. Kleine Unternehmen kommen folglich mit einem deutlich tieferen Organisationsgrad aus als grosse.
Zweitens ist Organisation kein Selbstzweck, sondern immer nur ein Werkzeug. Die Existenzberechtigung eines Unternehmens ergibt sich aus der Fähigkeit, Leistungen anzubieten, für die eine Nachfrage besteht. Prozesse, Strukturen und Projekte sind daher primär darauf auszurichten, diese Fähigkeit zu erhalten und zu stärken.
Dazu gehört auch, dass die Mitarbeiter sich in der Organisation zurechtfinden müssen. Die Komplexität sollte so hoch wie nötig, aber so tief wie möglich sein. Schaut man sich Konzepte wie Agile oder Holocracy an, stellen sich ob der Einhaltung dieses Postulats Zweifel ein.
Wenn man neue Organisationskonzepte im Hinblick auf das eigene Unternehmen prüft, sollte man sich also fragen, ob diese oder zumindest Teile davon das Unternehmen tatsächlich fitter machen. Und ob der erwartete Nutzen deutlich höher als die Kosten eines Umbaus ist.
Fällt die Antwort negativ aus, dann gilt, was auch für Holzfällerhemden, Schlaghosen, Plateausohlen gilt:
Man kann jede Mode mitmachen, muss aber nicht.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Was tun? (März 2020)
Fünf Ratschläge zum Umgang mit der wirtschaftlichen Krise in Zeiten von Corona
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Das Corona-Virus stellt eine Gefahr für die Gesundheit von uns allen dar. Die vom Bundesrat erlassenen Massnahmen sind daher vorbehaltlos zu begrüssen. Nichtsdestotrotz stürzen sie viele Unternehmen in eine tiefe Krise.
Wie damit umgehen? Hier fünf Ratschläge aus unternehmerischer Sicht:
1. Aufrechterhalten dessen, was noch läuft
Wenn Sie nicht, noch nicht oder nur teilweise betroffen sind, versuchen Sie unter allen Umständen noch vorhandene Kunden und Aufträge zu bedienen und damit die noch funktionierenden Unternehmensteile am Leben zu erhalten. Diese werden das Fundament für die Zeit nach der Krise bilden.
2. Kurzarbeit anmelden und Massnahmenpaket des Bundes nutzen
Wenn Sie einen Geschäftseinbruch zu verzeichnen haben, melden Sie so rasch wie möglich Kurzarbeit an. Die zuständigen Ämter sind bestrebt, Gesuche schnell und unbürokratisch zu bearbeiten. Damit schützen Sie die Löhne Ihrer Belegschaft und vermeiden Entlassungen.
Nutzen Sie weitere Optionen des Massnahmenpakets des Bundes wie verzugszinsfreie Zahlungsaufschübe bei der Mehrwertsteuer, den Sozialversicherungen oder bei Zöllen.
Link: https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/seco/nsb-news.msg-id-78515.html
3. Gespräch mit der Hausbank suchen
Wenn Sie nicht über Liquiditätspolster verfügen, nehmen Sie so schnell wie möglich Kontakt mit Ihrer Bank auf. Bei einbrechenden Umsätzen wird Ihre Zahlungsfähigkeit insgesamt leiden, nicht nur was die Löhne anbelangt. Die Banken werden zusammen mit dem Bund rasch unkomplizierte und tragbare Lösungen anbieten.
Sollten Sie jedoch in der glücklichen Lage sein, über genügend Liquidität zu verfügen, denken Sie an jene, die es härter trifft. Etwa indem Sie Ihren Kunden längere Zahlungsziele anbieten oder Lieferanten früher als vereinbart bezahlen. Sie werden es Ihnen danken.
4. Worst-Case-Szenario vorbereiten
Bereiten Sie ein Notfallszenario vor für den Fall, dass die Krise länger anhält als befürchtet oder der Umsatz dauerhaft einbricht. Das oberste Ziel dabei ist Schadensbegrenzung. Notfallpläne werden immer in der Hoffnung erstellt, dass man nie auf sie zurückgreifen muss. Dennoch ist es essentiell, für das Schlimmste gerüstet zu sein. Niemand würde den Betrieb eines Hochhauses bewilligen, welches über keinen Evakuationsplan im Brandfall verfügt. Seien Sie also vorbereitet.
5. Neue Handlungsoptionen ausloten
Versuchen Sie herauszufinden, wo Sie noch Spielräume haben. Können Sie beispielsweise neue Kanäle nutzen wie die Yogaschule, die Lektionen über Videokonferenz anbietet? Oder die lokale Brauerei, die einen Hauslieferdienst per Fahrrad aufgezogen hat? Können Sie Ihre Mitarbeiter übergangsweise in anderen Unternehmen unterbringen, die dringend Verstärkung brauchen (auch die gibt es im Moment)? Gibt es wichtige Projekte, für die Ihnen bisher die Zeit fehlte?
Sie sind der momentanen Situation nicht vollkommen ausgeliefert. Diese Ratschläge sollen Ihnen dabei helfen, Ihre Handlungsfähigkeit so gut es geht zu bewahren.
Wir wünschen Ihnen alles Gute und achten Sie auf Ihre Gesundheit.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi und Team
Energieschub für Unternehmer:innen - Bertasi Consulting Power Snack (Januar 2020)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Wie Ausdauersportler laufen, schwimmen, kämpfen Unternehmerinnen und Unternehmer ohne Unterbrechung. Oft sind sie dabei auf sich allein gestellt. Da können Kräfte und Orientierung schon mal nachlassen.
Mit unserem neuen, speziell für Unternehmerinnen und Unternehmer entwickelten
Bertasi Consulting Power Snack
erhalten diese den benötigten Energieschub, um die nächste Etappe zu meistern.
Konkret handelt es sich dabei um ein Beratungskontingent, das nach Bedarf verzehrt wird. Dessen Höhe und Gültigkeitsdauer werden im Voraus abgemacht und pauschal abgerechnet. Die Überschreitung der vereinbarten Menge von bis zu 50% bleibt für die Kunden ohne Kostenfolge.
Beispiel:
Eine Unternehmerin bucht für ein Quartal vier Stunden Beratung, drei in Form einer monatlichen stündigen Sitzung zum aktuellen Geschäftsgang und eine als Reserve für Notfälle. Weil es struber als erwartet zugeht, sind es am Schluss sechs Stunden. Die Unternehmerin bezahlt jedoch nur den abgemachten Preis.
Vorteile:
Das Angebot ist massgeschneidert: Die Kundin kann es völlig flexibel nach ihren Bedürfnissen zeitlich und inhaltlich zusammenstellen und abrufen.
Das Angebot ist sicher: Die Kundin hat die volle Kostenkontrolle. Auch kleinere Einheiten bezüglich Menge und Dauer sind möglich. So kann die Kundin uns testen.
Das Angebot ist effizient und nachhaltig: Der Rahmen muss nicht jedes Mal neu abgesteckt werden. Über die Zeit entsteht eine gemeinsame Wissensbasis und ein gestärktes Vertrauensverhältnis. Lange Erklärungen entfallen.
Kunden, die das Angebot bereits getestet haben, nehmen es weiterhin in Anspruch.
Wollen auch Sie Ihre Performance sichern? Dann kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches Gespräch.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Frauen machen den Unterschied (November 2019)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Frauen in Führungsetagen nicht zu berücksichtigen ist eine Verschwendung von Talent, die Unternehmen teuer zu stehen kommen kann. Das haben wir bereits in unserem Newsletter "Sag mir wo die Frauen sind" vom Juni 2018 festgehalten.
Nun hat das Research Institute der Credit Suisse die Resultate einer breit angelegten Studie präsentiert, die diese Aussage untermauern (The CS Gender 3000 in 2019: The changing face of companies). Dabei wurden 3000 Unternehmen aus 56 Ländern mit 30'000 Führungspositionen der obersten Managementstufe untersucht.
Was es kostet, Frauen zu ignorieren, belegt die folgende Grafik eindrücklich. Sie zeigt die Aktienperformance von Unternehmensgruppen mit unterschiedlichen Frauenanteilen in den wichtigsten Führungspositionen.
Aktienpreise spiegeln auf lange Sicht den relativen Unternehmenserfolg wider. Das heisst, man kann daraus ablesen, wer im Vergleich zu anderen besser und wer schlechter abgeschnitten hat.
Die erste Gruppe wies einen Frauenanteil von 30% oder mehr auf, die zweite einen von 20% oder mehr und die dritte einen von unter 15%. Alle untersuchten Unternehmen zusammen kamen auf einen Frauenanteil von 17%.
Die beste Performance erzielten die beiden Gruppen mit einem Frauenanteil von 20% und mehr. Ihr Aktienwert nahm um satte 110% zu. Das ist mehr als eine Verdoppelung! Der Aktienwert aller 3000 Unternehmen stieg im Beobachtungszeitraum um knapp 80%. Die Gruppe mit einem unterdurchschnittlichen Frauenanteil kam hingegen lediglich auf knapp 50%.

Die Zahlen sprechen für sich. Oder würden Sie auf die Gruppe mit dem tiefsten Frauenanteil setzen?
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Wenn zwei sich streiten (August 2019)
Die Gefahr von Pattsituationen
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Totalschaden oder schlimmer. Das droht, wenn sich zwei in einem fahrenden Auto ums Lenkrad streiten.
Aber wer sollte etwas so Absurdes tun? Ein solches Verhalten wäre völlig irrational und gefährlich.
Doch unsinnig heftige Auseinandersetzungen unter Geschäftseignern, die in einem Crash zu enden drohen, gibt es häufiger als man denkt. Und fast immer treten sie in KMUs auf, die von zwei Partnern zu je 50% gehalten werden.
Ein Streit zwischen gleichberechtigten Partnern führt schnell zu einer Pattsituation. Die macht ihn erst richtig gefährlich.
Weil jede Entscheidung einseitig blockiert werden kann, ist das Unternehmen im Konfliktfall nicht mehr steuerbar. So wird jedes Hindernis zur Gefahr, die Kollision kaum vermeidbar. Am Ende bleiben nur Verlierer: Mitarbeiter, Kunden und die Eigentümer selbst.
Wie kann das Risiko einer Pattsituation verringert werden?
Um beim Bild des Fahrzeugs zu bleiben: Man kann einerseits dafür sorgen, dass jederzeit klar ist, wer am Steuer sitzt. Die Entscheidungsmechanismen werden so festgelegt, dass es gar nie zu einer Pattsituation kommt.
Hierzu kann man beispielsweise von Beginn weg eine dritte Person in die Partnerschaft einbinden. Oder man gestaltet die Partnerschaft asymmetrisch, z.B. 60:40. Man kann Stichentscheide vorsehen oder eine ungerade Anzahl Verwaltungsräte. Sogar die Abmachung, dass bei Uneinigkeit das Los entscheidet ist denkbar.
Andererseits können, will man die Fahrt dennoch als gleichberechtigte Partner antreten, frühzeitig Ausstiegszenarien für den Notfall definiert werden. Darin wird der Ablauf einer geordneten Trennung festgehalten. Dabei sollen alle Beteiligten und das Unternehmen selbst möglichst schadlos davonkommen.
Dazu kann man sich zum Beispiel gegenseitig Kauf- und Verkaufsrechte einräumen. Jeder Partner kann die Anteile des anderen erwerben oder ihm seine Anteile verkaufen. Am besten wird dabei auch schon das Verfahren zur Bestimmung des Preises definiert (vgl. auch Newsletter Mai 2011).
Es gibt diverse Möglichkeiten, einen Totalschaden aufgrund von Konflikten abzuwenden. Im Idealfall befasst man sich mit ihnen, solange man noch vernünftig miteinander reden kann und setzt alles daran, Streit zu vermeiden.

Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Keine gute Medizin (Februar 2019)
Boni: Gravierende Risiken und Nebenwirkungen, teuer und unwirksam
Unlängst führten Freunde von mir ein Belohnungssystem ein, um ihre Kinder im Alter von sechs und acht Jahren zu mehr Mitarbeit im Haushalt zu motivieren. Für jede erledigte Arbeit gab es einen Pingpongball. Die Pingpongbälle kamen in eine Kartonröhre. War diese voll, erhielten die Kinder ein Spielzeug als Prämie.
Doch kaum waren die neuen Regeln in Kraft, änderte sich das Verhalten der Kinder. Sie machten nur noch, was ihnen einen Pingpongball einbrachte. Damit sie garantiert nichts umsonst taten, vergewisserten sie sich bei jeder Bitte um Hilfe jeweils unverzüglich, ob diese Aufgabe auch mit einem Ball belohnt würde.
Hatten sie vorher die eine oder andere Arbeit freiwillig erledigt, sei es aus purer Freude oder einfach, um den Eltern einen Gefallen zu tun, stellten sie solche Tätigkeiten nun fast vollständig ein.
Was bei Kindern beobachtet werden kann, verhält sich bei Erwachsenen nicht anders. Die durch Boni gesetzten Anreize führen zu einer Verdrängung anderer Motivationsquellen wie die Genugtuung durch die Bewältigung einer Aufgabe an sich, die Aussicht auf Selbstverwirklichung oder auf Zugehörigkeit. Der Fokus verschiebt sich. Die Belohnung wird zum wichtigsten Antreiber.
Die Veränderung der Motivationsstruktur ist nur eines der zahlreichen Probleme im Zusammenhang mit Boni. Hinzu kommen unter anderem Gewöhnung, Verwöhnung, Sesselkleberei und der Umstand, dass Boni tendenziell risikobereite sowie zur Selbstüberschätzung neigende Menschen anziehen. Und das alles bei nicht unerheblichen Kosten für die Ausgestaltung und Umsetzung von Bonusprogrammen. Ganz zu schweigen von den Kosten, die durch falsche Anreize entstehen können.
Die Idee hinter Boni ist bekanntlich Leistungssteigerung. Doch auch hierfür existieren keine Belege. Es gibt bis heute keine wissenschaftliche Untersuchung, die eine bessere Performance von Unternehmen mit Bonusprogramm als von solchen ohne nachweisen konnte.
Gravierende Risiken und Nebenwirkungen, teuer und erst noch unwirksam. Würde es sich bei Boni um Medikamente handeln, man würde sie vom Markt nehmen.
In der Praxis setzt sich diese Einsicht nur langsam durch. Doch einige Firmen handeln bereits, selbst solche aus dem Finanzwesen. So hat die Migros-Bank ab dem Geschäftsjahr 2019 Boni ganz abgeschafft .
Und meine Freunde? Ernüchtert haben auch sie den Versuch mit dem Belohnungssystem wieder aufgegeben und verwenden Pingpongbälle seither nur noch zum Spielen.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Mein neues Sportshirt (November 2018)
Wenn Marken austauschbar werden, können ethische Werte zum Alleinstellungsmerkmal avancieren.
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Wenn Produkte und Marken austauschbar sind, wenn jedes Waschpulver noch weisser wäscht und jeder Turnschuh noch hipper wippt, dann können ethische Werte zum Alleinstellungsmerkmal avancieren - sofern sie glaubwürdig vertreten werden.
Aus diesem Grund ist mein neues Sportshirt von Nike.
Nike traf zum 30. Jahrestag des "Just do it"-Slogans einen mutigen Entscheid. Das Unternehmen machte Colin Kaepernick zum Gesicht der Jubiläumskampagne, die im September startete. Die Botschaft: "Believe in something. Even if it means sacrificing everything."
Colin Kaepernick ist ein Football-Star und Afroamerikaner. Er war der erste, der sich während der amerikanischen Nationalhymne vor einem Spiel hinkniete, statt zu stehen. Damit wollte er ein Zeichen gegen Polizeigewalt und Rassismus gegen Schwarze setzen. Das kostete ihn seinen Job als Quarterback. Kaepernick ist seit 2016 ohne Vertrag und ohne Spiel.
Mit der Wahl Kaepernicks und der Kampagnenbotschaft hat sich Nike hinter den Athleten und seinen Protest gestellt.
Das Unternehmen hat sich dadurch aber auch den Zorn des amerikanischen Präsidenten zugezogen, fordert dieser doch unentwegt die Entlassung aller Athleten, die es Kaepernick gleichtun und während der Hymne knien. Donald Trump prophezeite sogar den Untergang der Firma ("…Nike is getting absolutely killed with anger and boycotts", Tweet vom 5. September 2018).
Das Risiko, das Nike einging, war tatsächlich nicht unerheblich. Niemand konnte wissen, wie die Kunden auf diese Aktion reagieren würden, besonders im so wichtigen Heimmarkt. In den ersten Tagen nach der Lancierung der Kampagne kursierten in den sozialen Medien denn auch Videos und Fotos von Leuten, die ihre Nike-Produkte verbrannten. Andererseits hat gerade die Inkaufnahme von wirtschaftlichen Nachteilen Nike eine hohe Glaubwürdigkeit beschert.
Mit diesem Positionsbezug hat sich Nike deutlich von der Konkurrenz abgehoben. Wie sich dies auf den Geschäftsgang auswirken wird, lässt sich noch nicht abschliessend beurteilen. Entgegen den Prophezeiungen des amerikanischen Präsidenten ist das Unternehmen bislang jedoch nicht untergegangen.
Bei mir jedenfalls hat es Nike ganz oben auf die Liste geschafft, wenn ich neue Sportartikel brauche.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
...und hier das Video zur "Just do it"-Kampagne
Sag mir wo die Frauen sind (Juni 2018)
Auf die Hälfte eines Talentpools zu verzichten kann sich auf Dauer niemand leisten.
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Der "War for Talents" tobt offenbar noch nicht mit voller Wucht. Wie sonst lässt sich erklären, dass der Frauenanteil in den Geschäftsleitungen der 118 grössten Schweizer Arbeitgeber nur 7% beträgt und in KMUs zweifelsohne noch tiefer ausfällt?
In Anbetracht der Tatsache, dass Führungstalent zwischen den Geschlechtern gleich verteilt ist, lässt der tiefe Frauenanteil nur einen Schluss zu: Diese Teams sind nicht aus den Besten zusammengesetzt!
Mag sein, dass bei der Zusammenstellung der Teams kurzfristig das Optimum herausgeholt wurde, weil auf die Schnelle keine besseren Kandidatinnen zu haben waren. Langfristig betrachtet lässt man so jedoch ein enormes Potential brachliegen. Schlau ist das nicht.
Es geht auch anders. Das zeigt das Beispiel der chinesischen Ctrip.com International Ltd., weltweit die zweitgrösste Reiseplattform nach Expedia. Das erfolgreiche Unternehmen macht einen Umsatz von 4 Mia. USD und erwirtschaftet dabei einen Gewinn von 340 Mio. USD.
Von den 30'000 Mitarbeitern sind über die Hälfte Frauen. Im mittleren Management stellen sie einen Anteil von 41% und im Senior Management von 33%. Die Positionen des CEO, CFO und COO sind durch Frauen besetzt.
Über Anstellung, Entlöhnung und Beförderung von Mitarbeitern entscheiden einzig Leistung und Qualifikation, nicht das Geschlecht. Frauen werden mit einer Reihe von Massnahmen und Einrichtungen darin unterstützt, Familie und Beruf zu vereinen. Diese reichen von kostenfreien Taxifahrten für Schwangere über Still- und Ruheräume bis hin zur hauseigenen Kinderbetreuung.
Während grosse Unternehmen sich solche Massnahmen leisten können, sind die Möglichkeiten von KMUs begrenzt. Kreative Lösungen lassen sich aber immer finden. Vorausgesetzt ist lediglich die Einsicht, dass es sich dabei um zukunftsweisende Investitionen und nicht bloss um Kosten handelt.
Schweizer KMUs sind oft in hochkompetitiven Branchen unterwegs. Aufgrund des hohen Preisniveaus müssen sie durch Qualität und Innovation zu überzeugen. Die Mitarbeiter sind hierbei die wichtigste Ressource, nicht zuletzt diejenigen in den Führungsetagen. Auf die Hälfte eines bereits begrenzten Talentpools zu verzichten kann sich deshalb auf Dauer niemand leisten.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Open Enterprise (März 2018)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Firefox ist für viele Anwender eine valable Alternative zu Microsoft Edge oder Google Chrome. Vier von fünf Smartphones werden mit Android betrieben und 90% aller Webserver laufen auf Linux.
Neben ihrem Erfolg haben Firefox, Android und Linux noch etwas gemeinsam: Es sind Open-Source-Applikationen. Ihr Quellcode ist für alle einsehbar. Im Gegensatz zur klassischen Closed-Source-Software steht ihnen eine beinahe unbegrenzte Anzahl Entwickler zur Verfügung. Jeder und jede kann zu Verbesserungen beitragen.
Im Bereich Unternehmensführung findet die Open-Source-Idee ihre Entsprechung im partizipativen Führungsstil. Dieser zeichnet sich durch hohe Wertschätzung von Mitarbeitern und ihren Fähigkeiten aus und dadurch, dass diese möglichst weitgehend in alle Entscheidungen einbezogen werden.
Flache Hierarchien, ein hoher Delegationsgrad, Teamarbeit sowie kurze und informelle Kommunikations- und Entscheidungswege sind weitere wichtige Merkmale. Unternehmenswissen fliesst ungehindert in alle Unternehmensbereiche. Man setzt auf kollektive Intelligenz, gern auch Schwarmintelligenz genannt.
Ein partizipativer Führungsstil ist der Gegenentwurf zum autoritären Führungsstil. Die Fähigkeit, in wichtigen Fragen gute Entscheidungen zu treffen, wird bei diesem nur wenigen Köpfen an der Spitze der Organisation zugetraut. Mitarbeiter werden als mehr oder minder wichtige Rädchen im Unternehmensgetriebe betrachtet und sind vor allem Befehlsempfänger. Wenig überraschend findet man diesen Führungsstil typischerweise bei militärischen Organisationen.
Im direkten Vergleich werden normalerweise die stärkere Identifikation und höhere Motivation der Mitarbeiter als Hauptvorteile des partizipativen Ansatzes genannt. Hingegen findet eine andere grosse Stärke selten Erwähnung: Das kreative Potential ist um ein Vielfaches höher als bei der autoritären Führung.
Gute Ideen können überall generiert, Entwicklungen von überall her angestossen werden. Entscheidungen sind fundierter und breiter abgestützt. Input von aussen kann schneller aufgenommen und verarbeitet werden.
Kreatives Potential im Vergleich
Organisation mit partizipativem Führungsstil

Organisation mit autoritärem Führungsstil

Damit aber tatsächlich eine Art Open Enterprise entstehen kann, in der sich die besten Ideen durchsetzen, braucht es zusätzliche Anstrengungen: Verrückte Einfälle, abweichende Meinungen und fundierte Kritik müssen nicht nur gefördert, sondern sogar eingefordert werden.
Dies mag zuweilen unangenehm sein, ist aber aus unserer Sicht unerlässlich. Schliesslich soll jeweils nicht der erstbeste Vorschlag leichtfertig durchgewunken werden. Genauso wenig dürfen sich einfach die lautesten Stimmen durchsetzen können. Sonst droht die vielgepriesene Schwarmintelligenz schnell zum Herdentrieb zu verkommen.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Informationen - die überflüssigen, die fehlenden und die richtigen (März 2017)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Am 15. Januar 2009 startete die Maschine des US-Airways-Fluges 1549 von LaGuardia, New York City, und flog kurz darauf in einen Schwarm Wildgänse. Sofort fielen beide Triebwerke aus. Die Flughöhe betrug noch keine 1000 Meter. Nach dreieinhalb Minuten Gleitflug setzte der Pilot das Flugzeug auf dem Hudson River auf. Alle 155 Insassen überlebten die Notwasserung.
In diesen dreieinhalb Minuten hatten die beiden Piloten folgenschwere Entscheidungen zu treffen. Dabei mussten sie eine Flut von Informationen bewältigen. Viele dieser Informationen waren zu umfangreich oder unvollständig. Dies erschwerte die Aufgabe der Piloten, statt sie zu erleichtern.
Unmittelbar nach dem Zusammenprall begann der Copilot die Checkliste für doppelten Triebwerksausfall abzuarbeiten. Diese war jedoch für ein Ereignis in 10'000 Metern Höhe ausgelegt. Der wichtige Hinweis, vor einer Notwasserung sämtliche Öffnungen der Maschine per Knopfdruck zu verschliessen, fand sich erst ganz am Schluss. Doch bis dorthin schaffte es der Copilot in der knappen Zeit gar nicht.
Zusätzlich zur Arbeit an den Notfallplänen standen die Piloten in ständigem Funkkontakt mit dem Tower und mussten sich untereinander abstimmen.
Je mehr sich die Maschine der Wasseroberfläche näherte, desto mehr Warnlampen, Signaltöne und Computerstimmen gingen an. Dabei sind es gemäss Experten hauptsächlich die Geschwindigkeitsanzeige und der Blick aus dem Cockpitfenster, welche die wichtigsten Informationen zur Steuerung eines Flugzeugs im Gleitflug liefern. Captain Chesley "Sully" Sullenberger gab später zu Protokoll, es sei nicht ganz einfach gewesen, sich von den vielen Tönen und Anzeigen nicht ablenken zu lassen.
Obschon es dabei glücklicherweise nicht um Leben und Tod geht, stellt das Auseinanderfallen von Informationsangebot und Informationsbedarf (vgl. Abbildung weiter unten) auch in den meisten Unternehmen ein ernstzunehmendes Problem dar. Denn einerseits resultieren daraus in der Regel schlechtere Entscheidungen und andererseits werden Ressourcen verschwendet.
Schlechtere Entscheidungen werden getroffen, wenn zu viele irrelevante Informationen vom Wesentlichen ablenken oder wichtige Informationen ganz fehlen.
Nutzlose Informationen führen gleich in mehrfacher Hinsicht zur Verschwendung kostbarer Ressourcen. Einerseits entsteht durch das Sammeln, Aufbereiten und Weitergeben von Informationen ein erheblicher Aufwand. Anderseits wenden auch die Empfänger Zeit und Aufmerksamkeit auf, um Informationen zu verstehen und einzuordnen.
Das Ziel muss also sein, Informationsbedarf und -angebot möglichst übereinstimmend zu gestalten. Diesem Zweck dient folgendes Massnahmenpaket:
- Überflüssige Informationen eliminieren.
- Nützliche Informationen optimieren.
- Fehlende Informationen generieren.

"Back to basics!" forderte Sullenberger im Nachgang zur gelungenen Notwasserung. Es brauche vor allem in Notsituationen weniger Informationen, dafür die richtigen. Für einen Triebwerksausfall in geringer Höhe hilft zum Beispiel nur eine sehr kurze Checkliste, welche die wichtigsten Punkte enthält. Heute gehört eine solche zum Standard.
Der Informationsbedarf in Unternehmen verändert sich ständig. Darum sollte auch das Informationsangebot immer wieder den Bedürfnissen angepasst werden. Es geht dabei nicht nur um Effizienz, sondern insbesondere auch um die Qualität von Entscheidungen. In diesem Sinne wünschen wir viel Erfolg und stehen bei Bedarf jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Schauplätze (Januar 2017)
Daten und Karten verbinden
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Eine Grafik sagt mehr als tausend Tabellen. Dies gilt umso mehr, wenn die Grunddaten geografische Informationen wie Koordinaten, Postleitzahlen oder Länderbezeichnungen enthalten.
Mit der Darstellung relevanter Grössen auf Landkarten lassen sich räumliche Zusammenhänge und Entwicklungen intuitiv begreifen und einfach vermitteln.
Die folgende Bildserie illustriert das deutlich: Auf Anhieb erschliesst sich, wie der Umsatz des Unternehmens X zunächst in den wirtschaftliche Zentren Zürich, Zug und Genf erzielt wurde und wie dieser mit der Zeit auf weitere Gebiete ausgedehnt werden konnte.

Bislang konnten solche Charts nur mit vergleichsweise hohem Aufwand oder mit spezialisierten Programmen erstellt werden. Zunehmend bieten jedoch auch herkömmliche Tabellenkalkulationsprogramme entsprechende Funktionalitäten an.
Mit welcher Applikation auch immer, nutzen Sie diese Darstellungsmöglichkeiten, um Ihr Geschäft besser zu verstehen und weiter zu bringen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viele inspirierende Einsichten bei der Analyse Ihrer Daten und stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
PS Animiert lassen sich Entwicklungen gar noch einfacher und rascher erfassen.
Die Kraft guter Geschichten (September 2016)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Im August dieses Jahres bot Samantha Wagg aus Grossbritannien ihr Hochzeitskleid auf eBay zum Verkauf, um die Kosten ihrer Scheidung zu begleichen. Den Anfangspreis setzte sie bei 500 £ an.
Neu habe das Kleid rund 2'000 £ gekostet, schrieb Wagg dazu. Ihre Eltern hätten es ihr zur Trauung geschenkt. Sie habe darin ausgesehen wie eine Prinzessin.
Das Kleid sei in sehr gutem Zustand, bis auf etwas Schmutz am Saum. Leider habe die Zeit gefehlt, es zur Reinigung zu bringen, bevor ihr betrügender Mistkerl von Ehemann sie nach nur zwei Jahren Ehe wegen einer anderen verlassen habe. Es gebe auch bloss zwei Bilder des Kleides, denn sie habe alles zerstört oder gelöscht, worauf sein abscheuliches Gesicht zu sehen gewesen sei.
Wer ein Kleid voller schlechter Erinnerungen und zerstörter Träume kaufen wolle, finde hier genau das Richtige. Sie hoffe, dass es der neuen Besitzerin mehr Freude bereite als ihr, schloss Wagg, und wenn nicht, dann könne diese es ja jederzeit wieder auf eBay verkaufen.
Das ungewöhnliche Inserat machte Furore. Die Gebote jagten sich. Samantha Wagg verkaufte ihr Kleid für satte 69'500 £!
Soweit Samantha Waggs Story. Ich hätte sie natürlich auch weglassen können und gleich auf die Wirkungen zu sprechen kommen, die gute Geschichten entfalten können: Dass sie aus einfachen Dingen etwas Besonderes machen. Dass sie unsere Sicht der Dinge verändern. Dass sie nicht nur den Kopf, sondern auch das Herz ansprechen. Dass wir uns in die Protagonisten hineinversetzen können, auch wenn wir noch nie dasselbe erlebt haben. Dass sie unsere Aufmerksamkeit stärker fesseln und tiefer in unserem Gedächtnis haften bleiben als blosse Fakten oder rationale Argumente es je vermögen. Doch ohne Samantha Wagg wären diese Gedanken blutleer. Die Verbindung mit ihrer Geschichte haucht ihnen Leben ein, macht sie fassbar und verständlich.
In jeder Kultur finden sich zahllose Sagen, Mythen und Märchen. Religionen sind ohne Geschichten und Gleichnisse undenkbar. Legenden können das Selbstverständnis ganzer Nationen prägen. Wir alle kennen den Wilhelm Tell oder den Rütlischwur und verbinden damit Werte wie Unbeugsamkeit und Freiheit. Wie viele wissen aber, dass die Schweiz in der heutigen Form als moderner Bundesstaat 1948 entstanden ist und welche Bedeutung dies selbst heute noch hat?
In Unternehmen können Geschichten Visionen und Ideen transportieren. Sie sind ein hervorragendes Instrument, um Wissen weiterzugeben oder ethische Werte zu vermitteln. Sie schaffen Gemeinsamkeit und Zugehörigkeit. Sie sind Logbuch und Anker, Karte und Kompass, Segel und Wind, manchmal alles zusammen. Und: sie sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, sich von anderen abzuheben.
Erfolgreiche Produkte und Unternehmen werden in der Regel von guten Geschichten begleitet. Denken Sie nur an Dyson (unzählige Prototypen, bis die Vision des perfekten Staubsaugers erreicht war), Freitagtaschen (from truck till bag), Turbinenbräu (Bier für Zürich) oder Swatch (die Rettung der Schweizer Uhrenindustrie). Finden und erzählen auch Sie Ihre Geschichten.
Wir sind gespannt und stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Dem Schrecken ein Ende setzen (Juli 2016)
Projekte im Notfall abbrechen können
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Bestimmt erinnern Sie sich noch an die Expansionsstrategie der Swissair, an den Übernahmeversuch von VW durch Porsche oder an "Insieme", das Informatikprojekt des Bundes. Alles grandios gescheiterte Projekte. "Insieme" hat den Steuerzahler über 100 Mio. Franken gekostet. Der Angreifer Porsche wurde von seiner Beute VW geschluckt. Die Swissair existiert nicht mehr.
Jedes Projekt stellt eine Expedition ins Ungewisse dar. Man geht Risiken ein, weil am Ende der Reise eine Belohnung winkt, die den Einsatz zu rechtfertigen verspricht. Das ist die Quintessenz allen unternehmerischen Handelns.
Vorhaben mit ungewissem Ausgang grundsätzlich zu vermeiden kann also keine Option sein. Dass Projekte zuweilen abgebrochen werden müssen hingegen schon. Deshalb sollte jede gute Projektplanung auch ein Abbruchszenario enthalten.
Doch weshalb fällt es in der Praxis so schwer, ein Projekt abzubrechen, das zu misslingen oder gar in einem Desaster zu enden droht? Warum hat bei obigen Beispielen niemand rechtzeitig die Reissleine gezogen? Deutliche Warnsignale gab es sicherlich mehr als genug.
Die Gründe dafür können vielfältig sein. Neben Fehleinschätzung der Situation und Überschätzung der eigenen Fähigkeiten spielt die Identifikation mit dem Vorhaben eine zentrale Rolle: Für die Beteiligten sind Projekte wie eigene Kinder. Man will sie wachsen und gedeihen sehen und fördert sie mit grossem Einsatz. Ihr Scheitern käme einer persönlichen Niederlage gleich.
So wichtig Identifikation, Hingabe und Engagement für den Projekterfolg sind, so gefährlich können sie werden, wenn sie das Urteilsvermögen trüben. Die grosse Herausforderung besteht also darin, in wichtigen Entscheidungssituationen emotionale Distanz zwischen den Entscheidungsträgern und dem Projekt herzustellen.
Dies kann auf drei Arten geschehen:
-
Das Projektteam versucht selber Abstand zu nehmen und Antworten zu finden. Dabei können sogenannt dissoziierende Fragen helfen, wie z.B. "Was würden wir guten Freunden raten, die sich in derselben Lage befinden?" oder "Was würde eine Person, die diese Situation völlig im Griff hat, jetzt tun?"
-
Zu Beginn eines Projektes oder einer Projektphase werden klare Abbruchbedingungen definiert. Wenn diese eintreten, wird das Vorhaben beendet. Niemand verliert dabei das Gesicht.
-
Es werden Personen einbezogen, die weder bei der Entwicklung der Projektidee, noch bei der Realisierung des Projektes stark involviert waren bzw. sind. Ihnen fällt eine nüchterne, sachliche Beurteilung der Situation leichter als direkt beteiligten Personen.
In aussichtsloser Situation wählt man lieber ein Ende mit Schrecken als einen Schrecken ohne Ende. Vorausschauende Unternehmer rechnen mit allen Eventualitäten und schaffen Rahmenbedingungen, die im Notfall auch einen Projektabbruch erlauben.
Wir wünschen Ihnen wie immer gutes Gelingen und stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Was macht Teams erfolgreich? (Februar 2016)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Letzten Herbst beschrieb ein VW-Ingenieur, wie der Konzern im Rahmen des sogenannten VW-Abgasskandals die CO2-Werte manipulierte (NZZ, 9.11.2015). Als Grund für diese Handlungen nannte er den hohen Druck seitens des Managements. So habe der frühere VW-Chef Winterkorn im März 2012 die Devise ausgegeben, den Ausstoss von CO2 bis 2015 um 30% zu verringern. Dieses ambitionierte Ziel habe man mit legalen Mitteln nicht erreichen können, so der Mitarbeiter weiter. Gleichzeitig fehlte offenbar der Mut, den Vorgesetzten die unangenehme Wahrheit zu sagen. Kein Wunder, denn laut anderen Quellen herrschte unter Winterkorn ein Klima der Angst.
Angst ist ein schlechter Begleiter. Der VW-Konzern sieht sich nun weltweit mit Schadensersatzklagen, drohenden Bussen und Rückrufaktionen konfrontiert, welche Kosten in zweistelliger Milliardenhöhe verursachen werden. Hinzu kommen Umsatzeinbussen infolge des verspielten Vertrauens. Dementsprechend hat sich der Aktienkurs bereits halbiert. Wer solche Szenarien vermeiden will, tut gut daran, in seinem Unternehmen eine Kultur des Respekts, des Vertrauens und der Anerkennung zu fördern.
Dadurch wird aber noch weitaus mehr erreicht. Etwa gleichzeitig mit den Enthüllungen des VW-Ingenieurs erschienen die Resultate einer internen Google-Studie. Diese hatte zum Ziel herauszufinden, was erfolgreiche Teams ausmacht. Dazu wurden über 180 Teams anhand von rund 250 Variablen untersucht und mehr als 200 Interviews geführt. Google ist eine Analysemaschine, und mit über 50'000 Mitarbeitern war zudem eine gute Datenbasis vorhanden.
Das Resultat überraschte. Die Zusammensetzung eines Teams etwa in Bezug auf Fähigkeiten, Erfahrung oder Persönlichkeiten spielt eine untergeordnete Rolle. Entscheidend ist hingegen wie ein Team harmoniert, wie es seine Arbeit strukturiert und wie die einzelne Teammitglieder ihre Bedeutung und ihren Beitrag wahrnehmen.
Psychological Safety (psychologische Sicherheit) zeigt sich hierbei als der mit Abstand wichtigste Faktor. Die psychologische Sicherheit ist umso grösser, je einfacher es Einzelnen fällt, sich gegenüber anderen im Team zu exponieren, ohne dass sie eine Blamage oder Repressionen fürchten müssen. Fragen, Kritik, gewagte Vorschläge oder Bedenken können also frei geäussert werden, denn man ist sich der Wertschätzung der anderen Teammitglieder gewiss. Nur wenn ein hohes Mass an psychologischer Sicherheit besteht, können Teams ihr gesamtes Potential ausschöpfen.
Die Basis erfolgreicher Unternehmen bilden heutzutage nicht mehr grandiose Einzelkämpfer, sondern hervorragende Teams. Investitionen in gute Teamarbeit dienen somit nicht nur der Risikominimierung, sie sind eine Voraussetzung für nachhaltig gute Resultate. In diesem Sinne hoffen wir, einen kleinen Denkanstoss gegeben zu haben und stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
In eigener Sache (Oktober 2015)
Anpassungen Webpage
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Ausnahmsweise erhalten Sie diesmal einen Newsletter in eigener Sache.
Im Verlauf der Jahre hat sich Bertasi Consulting immer stärker auf die Beratung eigentümergeführter Unternehmen konzentriert. Das haben wir nun auch auf unserer Webpage festgehalten.
Gleichzeitig haben wir alle Texte so überarbeitet, dass rascher fassbar wird, was von Bertasi Consulting erwarten werden darf.
Ihnen wünschen wir einen erfolgreichen Jahresabschluss und stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Was macht Ihr Geschäft? – Teil II (Juli 2015)
Purpose Statement und Unternehmenszweck
In unserem letzten Newsletter ging es um das Purpose Statement, das den Unternehmenszweck knapp und präzis wiedergeben soll. Daraufhin wurden sowohl zum Purpose Statement als auch zum Unternehmenszweck interessante Fragen gestellt, die wir hier aus unserer Sicht beantworten:
-
Sollte das Purpose Statement nicht auch die Einzigartigkeit eines Unternehmens zum Ausdruck bringen?
Unbedingt! Es geht nicht zuletzt auch um Differenzierung, also darum, sich von Konkurrenz abzuheben. Im Idealfall kann ein Purpose Statement einem Unternehmen eindeutig zugeordnet werden. Ein gutes Beispiel hierfür: "…'s mission is to organize the world’s information and make it universally accessible and useful". Auch wenn der Name weggelassen wird ist Google hier leicht zu erkennen.
-
Kann sich der Unternehmenszweck über die Zeit verändern?
Grundsätzlich sollte der Unternehmenszweck eine gewisse Dauerhaftigkeit aufweisen. Von ihm hängen schliesslich Art und Höhe der Investitionen und die Zuteilung der Ressourcen ab. Ein Paradebeispiel für Beständigkeit findet sich in der japanischen Firma Kikkoman, die schon seit 300 Jahren Sojasauce herstellt.
Neue Chancen oder ein verändertes Marktumfeld können jedoch Anpassungen erfordern. So produzierte Nokia im Verlauf seiner Geschichte Gummistiefel, Fernseher und Mobiltelefone, um schliesslich – nicht ganz freiwillig – zu einem der wichtigsten Netzwerkausrüster für die Telekommunikationsbranche zu mutieren. -
Kann ein Unternehmen verschiedene Unternehmenszwecke aufweisen?
Wenn ein Unternehmen unterschiedliche Kundensegmente mit unterschiedlichen Bedürfnissen bedient und dafür unterschiedliche Lösungen anbietet, also Produkte und Dienstleistungen, erfüllt es in der Regel auch unterschiedliche Zwecke.
Ein klassisches Beispiel hierfür ist die Bäckerei mit angegliederter Cafeteria. Kunden der Bäckerei und Kunden der Cafeteria können, müssen aber nicht identisch sein. Unterschiedliche Bedürfnisse werden befriedigt: Auf der einen Seite geht es primär um Nahrung, Genuss, Gesundheit und Frische, auf der anderen um Zeitvertreib und soziale Kontakte. Entsprechend unterscheidet sich das Angebot, trotz Überschneidungen.
Bei der Bäckerei besteht es in erster Linie aus den Backwaren. Bei der Cafeteria hingegen aus einem Mix aus Getränken, Ambiente und Service, das durch Produkte aus der Bäckerei ergänzt wird. Die Erweiterung des Tätigkeitsbereichs mag aus Sicht der Bäckerei als logischer Schritt erscheinen, beispielsweise um die Backstube besser auszulasten. Es wäre jedoch ein Fehler, die grundlegenden Unterschiede zwischen den beiden Bereichen zu ignorieren.
Ob Einzigartigkeit, Anpassung oder Erweiterung des Unternehmenszwecks: es geht dabei immer und ausschliesslich um die Wahrnehmung durch die Kunden. Erst sie verleihen dem Unternehmen seine Daseinsberechtigung. Was trivial klingt, kann im unternehmerischen Alltag leicht vergessen gehen. Erfolgreiche Unternehmen sorgen dafür, dass dies bei ihnen nicht geschieht. In diesem Sinne wünschen wir einen aufmerksamen Blick und stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Was macht ihr Geschäft? (Mai 2015)
Purpose Statement
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Die Existenzberechtigung von Unternehmen ergibt sich aus deren Fähigkeit für Kunden Probleme zu lösen. Verschwindet das Problem oder ist die Lösung nicht mehr gut genug, gehen sie unter. Dieses Schicksal ereilte zum Beispiel Hufschmiede und Schreibmaschinenhersteller.
Der Unternehmenszweck ist also von zentraler Bedeutung. Daher empfiehlt es sich, ihn schriftlich festzuhalten; in einem Purpose Statement, oft auch Mission Statement genannt. Einerseits sichert man so das gemeinsame Verständnis der Kernaufgaben des Unternehmens: Man benennt den Strick, an dem alle zusammen ziehen sollen. Andererseits wirkt ein klares Statement sinnstiftend und motivierend: Die Mitarbeiter können ihre Tätigkeit in einen grösseren Kontext einordnen und die Wichtigkeit ihres Beitrages besser verstehen.
Ein Purpose Statement lässt sich mit Hilfe der folgenden Fragen formulieren: Was tun wir eigentlich und für wen? Wozu sind wir da? Warum gibt es uns? Was würde der Welt fehlen, wenn es uns nicht gäbe?
Das Statement sollte konkret, verständlich und kurz gefasst sein - idealerweise findet es auf einem T-Shirt Platz und jeder Mitarbeiter kann es aus dem Gedächtnis in eigene Worte fassen.
Statt prägnanter Aussagen findet man jedoch allzu oft nur beliebige Anordnungen Deutscher oder Englischer Worthülsen wie "flexible, dynamische Partner", "mit kreativen Lösungen", "wir möchten inspirieren", "most successful", "market-leading", "superior services/technologies/products/…", "best customer value" oder "best customer experience". Abgehobene, nichtssagende und häufig viel zu lang geratene Elaborate, von denen sich niemand angesprochen fühlt und die man sogleich wieder vergisst. Man hätte sich die Mühe sparen können, sie überhaupt zu formulieren.
Es gibt aber löbliche Ausnahmen, wie diese Beispiele zeigen:
-
GLOBETROTTER – REISEN STATT FERIEN
Das Reisen in anderen Kulturkreisen gehört zu den wertvollsten Erfahrungen, da es das Leben bereichert und für viele eine gute Lebensschule ist. Der Sinn unserer Tätigkeit ist, den Kunden organisatorisch und inhaltlich zu optimalen Reisen mit grosser Erlebnisfülle zu verhelfen.
-
H&M
Our business concept
Fashion and quality at the best price
REA Group (Australische Internet-Immobilienplattform)
To make the property process simple, efficient, and stress free for people buying and selling a property.*
Bei diesen Statements weiss man gleich, worum es geht. Die Kraft, die sie entfalten, ist ohne weiteres spürbar. Mitarbeiter erhalten einen Entscheidungs- und Handlungsrahmen, der viele Weisungen und Reglemente überflüssig macht. Aussenstehenden wird sofort klar, was sie von diesen Firmen erwarten dürfen.
Den Unternehmenszweck in knappen und klaren Worten treffend zu beschreiben ist nicht nur eine Kunst, sondern ein wichtiger Baustein zum Erfolg. In diesem Sinne wünschen wir die richtige Eingebung und stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
*Greg Ellis, ehemaliger CEO und Managing Director von REA Group, zitiert in "Your Company’s Purpose Is Not Its Vision, Mission, or Values", Harvard Business Review, 3.9.2014.
Hat der Laden ausgedient? (Februar 2015)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Immer mehr Waren werden heute übers Internet gekauft. Schätzungen gehen von bis zu 15% des Detailhandelsumsatzes aus. Tendenz weiter steigend. Was mit der Digitalisierung von Musik, Büchern und Filmen begann, hat längst die Mehrzahl der Produkte erfasst: Toaster, Handys, Fernseher und selbst Kleider und Möbel werden zunehmend bequem per Mausklick erworben.
Der Nutzen für den Konsumenten liegt auf der Hand: Das Angebot ist riesig. Produkte und Preise lassen sich einfach vergleichen. Bewertungen von anderen Käufern erleichtern die Kaufentscheidung. Die Lieferung erfolgt gewöhnlich bereits am Tag nach der Bestellung. Selbst Rückgabe und Rückerstattung bei Nichtgefallen werden anstandslos gewährt und sind kinderleicht abzuwickeln.
Doch der Online-Handel vermag nicht alle Bedürfnisse abzudecken: Kunden wollen Waren berühren und testen. Sie wollen den Stoff fühlen, das Sofa probesitzen. Sie wollen auf einen momentanen Reiz reagieren und einem spontanen Impuls nachgeben. Sich vom frischen Spinat und den Belugalinsen zu einem feinen Abendessen inspirieren lassen. Und sie schätzen es, wenn sie das vergessene Katzenfutter auch noch abends um 22 Uhr rasch um die Ecke besorgen können. Einkaufen ist mehr als bloss Güter erwerben. Es ist ein Erlebnis, welches soziale Kontakte ermöglicht und Spass machen kann.
Genau hier liegen die Chancen des klassischen Detailhandels. Denn solche Bedürfnisse lassen sich (fast) nur in der realen Welt befriedigen. Aber es muss etwas Besonderes geboten werden! Dem Zusammenspiel von Warenangebot, Lage, Gestaltung und Einrichtung des Ladens, Öffnungszeiten und persönlicher Beratung kommt dabei entscheidende Bedeutung zu.
Stellen Sie sich japanische Möbel vor, eingetaucht in warmes Licht und gedämpfte Gongklängen. Beim Betreten des Geschäfts wird Ihnen ein Tee offeriert. Mit feiner Zurückhaltung und beeindruckender Kompetenz erklärt Ihnen die Inhaberin die Raumteiler, nach denen Sie sich erkundigt haben. Ihr Wissen erweitert sie jedes Jahr während eines mehrwöchigen Japanaufenthalts.
Oder Sie gehen ins Lebensmittelgeschäft in Ihrer Nähe. Es ist spät - der Laden ist noch immer geöffnet. Es riecht nach Wurst und Käse, hauptsächlich Sorten aus der Region. Der Verkäufer grüsst Sie bei Namen. Weil er Ihre Vorlieben kennt, empfiehlt er Ihnen den Mönchsbart sowie die frisch eingetroffenen Pastinaken. Sie gucken etwas ratlos. Er gibt Ihnen einen passenden Rezepte-Tipp, während er die Waren sorgfältig in eine Papiertüte verpackt.
Das Ladengeschäft als Verkaufskanal hat noch lange nicht ausgedient. Aber die Herausforderungen sind gross. Der klassische Detailhandel muss sich auf seine eindeutigen Stärken besinnen und Terrain vermeiden, in welchem der Onlinehandel klar im Vorteil ist.
In diesem Sinne: der Laden ist tot – es lebe der Laden!
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
PS In einer nicht allzu fernen Zukunft werden die Grenzen zwischen On- und Offlinewelt verwischen. Aber das ist eine andere Geschichte.

Quelle: diesunddas.net/kunden-die-dieses-produkt-gekauft-haben-kauften-auch
Pricing - ein weites Spielfeld (September 2014)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
"Wir können unsere Preise nicht selber bestimmen. In unserer Branche werden sie von aussen diktiert. Wir können nur versuchen, die Konkurrenz zu unterbieten." Solche oder ähnliche Aussagen hören wir immer wieder, besonders von KMU-Seite.
Dabei gibt es genügend Beispiele, die in eine andere Richtung weisen. Neue Preismodelle werden laufend und in allen Branchen lanciert. So brach Apple mit iTunes das Musikalbum auf und begann Titel einzeln zu verkaufen. Andere Anbieter entwickelten ähnliche Modelle, verrechnen aber nicht den Titel, sondern die entsprechende Datenmenge. Länge und Bitrate des heruntergeladenen Stücks bestimmen hier den Preis. Einen ganz anderen Weg beschreitet Spotify: gegen eine Abonnementsgebühr erhält man Zugriff auf mehrere Millionen Musikstücke.
Auch im Kleinen befindet sich die Preiswelt in ständiger Bewegung. Ein uns bekannter Heizungsmonteur bietet Heizungserneuerungen als umfassende Dienstleistung aus einer Hand an - und dies in hervorragender Qualität. Zusätzlich zu seinen eigenen Arbeiten erledigt er die Kommunikation mit Ämtern, holt Bewilligungen ein und koordiniert die involvierten Handwerker. Verwaltung und Hauseigentümer brauchen sich um nichts zu kümmern, sparen Zeit und Geld. Bei diesem Paket entscheidet nicht primär der Preis, sondern der Inhalt über die Auftragsvergabe. Weitere Beispiele sind der Coiffeur, der Föhnen und Styling seinen Kunden überlässt und so günstiger abrechnen kann oder das Café, welches Kafi und Gipfeli zusammen zum Spezialznünipreis offeriert.
Die Grenzen der Preisgestaltung werden durch die Zahlungsbereitschaft der Kunden, die Konkurrenz und die Selbstkosten gesetzt. Innerhalb dieses Rahmens besteht weit mehr Spielraum als man denkt. Und selbst diese Grenzen lassen sich verschieben, was bisweilen zu völlig neuen Geschäftsmodellen führen kann, wie das Beispiel von Spotify zeigt.
Zentral ist wie so oft ein gutes Verständnis der anvisierten Kundensegmente. Wer die Bedürfnisse der Kunden kennt und weiss, welchen Wert sie entsprechenden Produkten oder Dienstleistungen beimessen, hält den Schlüssel zu massgeschneiderten Entschädigungsmodellen in der Hand.
Mögliche Ansätze reichen von Bundling oder Unbundling von Leistungen (Café, Heizungsmonteur / Coiffeur) über Differenzierungen (Schüler- und Studentenrabatte) oder zeitliche Staffelungen (Saisonausverkauf), bis hin zu Penetrations- oder Abschöpfungsstrategien (tiefe Einführungspreise, die danach steigen / hohe Einführungspreise, die danach sinken), um nur einige zu nennen.
Erfolgreiche Unternehmen nutzen den vorhandenen Gestaltungsraum aus und betreiben eine aktive Preispolitik, die zu ihren Kunden und Leistungen passt. Dadurch stärken sie ihre Positionierung im Markt und erwirtschaften höhere Erträge. Einigen gelingt es sogar, die Spielregeln komplett neu zu definieren und zum Branchenleader aufzusteigen. In diesem Sinne wünschen wir gute Pricingideen und stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Strategiereviews (Mai 2014)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
In unserem letzten Newsletter ging es um Strategieumsetzung. Dabei kam ein häufig anzutreffendes Phänomen zur Sprache, nämlich dass die Implementierung einer neuen Strategie nach einiger Zeit ins Stocken gerät und schliesslich ganz erlahmt. Als einfaches und wirksames Mittel gegen dieses Problem bietet sich die Durchführung regelmässiger Strategiereviews an.
Strategiereviews helfen, anvisierte Ziele nicht aus den Augen zu verlieren, das Tempo hoch zu halten und somit den Elan und die Motivation aller Beteiligten zu bewahren. Folgende Punkte bezüglich Inhalt, Verantwortung und Frequenz sind dabei zu beachten:
Ergebnis-, Massnahmen- und Grundlagenkontrolle bilden die inhaltlichen Schwerpunkte.
Im Rahmen der Ergebniskontrolle werden tatsächlich erzielte mit den erwarteten Zwischenresultaten verglichen, Abweichungen analysiert und gegebenenfalls Korrekturen eingeleitet.
Bei der Massnahmenkontrolle wird geprüft, ob die geplanten Massnahmen auch wirklich umgesetzt wurden und ob sie wie beabsichtigt greifen.
Bei der Grundlagenkontrolle schliesslich wird untersucht, ob unvorhergesehene Entwicklungen eine wesentliche Anpassung der Strategie erfordern. Das können zum Beispiel Ereignisse wie die Finanzkrise oder massive politische Umwälzungen in den Zielmärkten sein.
Strategiereviews gehören in den Verantwortungsbereich der Unternehmensleitung. Durch ihre Präsenz und die Leitung der Gespräche verleiht sie den Meetings das nötige Gewicht. Die Unternehmensleitung setzt die Meetings an und sorgt dafür, dass die richtigen Personen teilnehmen. Sie stellt auch sicher, dass alle wirklich relevanten Themen besprochen werden und die Treffen in einer fruchtbaren Atmosphäre stattfinden.
Zur Frage, wann beziehungsweise wie oft solche Lagebesprechungen abgehalten werden sollen, gibt es unterschiedliche Ansätze. Normalerweise orientieren sich die Sitzungstermine an den festgelegten Meilensteinen. Um die produktive Spannung nicht absinken zu lassen, sind regelmässig wiederkehrende Meetings jedoch besser geeignet. Je kürzer die Intervalle, desto grösser die Aufmerksamkeit für das Projekt. Daher plädieren wir für einen monatlichen Rhythmus, selbstverständlich unter Berücksichtigung der Meilensteine.
Regelmässige Strategiereviews sind ein wichtiger Schlüssel zur effektiven Strategieumsetzung. Erfolgreiche Unternehmen wenden dieses Instrument konsequent an. In diesem Sinne wünschen wir ergiebige Diskussionen. Bei Bedarf stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Do it! (Februar 2014)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Als Sergio Marchionne im Juni 2004 zum CEO von FIAT ernannt wurde, hätte wohl niemand mehr auf die Zukunft des Konzerns gewettet. Die Situation war desolat. Eine Reihe von Fehlinvestitionen belastete das Unternehmen schwer. Die Schulden gingen in die Milliarden, die Firma schrieb Verluste. Der letzte Hoffnungsträger, Umberto Agnelli, war kurz zuvor seinem Krebsleiden erlegen.
Doch mit der Lancierung neuer Modelle wie dem "Nuova Panda" oder dem "Cinquecento" begann der Turnaround. Die einengende Allianz mit GM wurde aufgelöst. Neu ging man produktspezifische Kooperationen mit anderen Herstellern ein.
Schritt für Schritt kam das Unternehmen in die Gewinnzone zurück und baute Schulden ab. 2009 war FIAT gar in der Lage - und auch mutig genug - bei der damals unter Gläubigerschutz stehenden Chrysler einzusteigen. Vor wenigen Wochen übernahm FIAT die Amerikaner schliesslich ganz. Heute ist Chrysler die Cash Cow des Konzerns.
Die Erfolgsgeschichte FIATs zeigt, dass es nicht nur auf die richtigen strategischen Ideen ankommt, sondern vor allem auf deren konsequente Umsetzung. Doch gerade bei der Umsetzung gerät der Motor häufig ins Stottern und stirbt nicht selten ganz ab.
Risikoaversion und Bequemlichkeit des Managements oder schlicht dessen Absorption durch das Tagesgeschäft sind mögliche Gründe hierfür; ebenso Widerstände seitens der Belegschaft oder weiterer Anspruchsgruppen.
Die Folgen sind nicht zu unterschätzen. Neben der Verschwendung von Mitteln sind in erster Linie die Frustration engagierter Mitarbeiter zu nennen sowie das Risiko, im Wettbewerb ins Hintertreffen zu geraten.
Die Realisierung einer neuen strategischen Ausrichtung involviert die Angestellten aller Stufen. Letzten Endes muss sie sich in der konkreten, täglichen Arbeit zeigen. Der Schlüssel zur Umsetzung liegt jedoch bei der obersten Unternehmensführung.
Sie muss die Mitarbeiter ins Boot holen und deren Motivation während des gesamten Veränderungsprozesses hoch halten. Dazu braucht sie eine überzeugende Vorstellung davon, wie das Unternehmen in Zukunft aussehen soll und wie dieser Zustand erreicht werden kann. Sie muss diese Ideen zudem verständlich vermitteln und dafür sorgen, dass jeder Einzelne weiss, was er persönlich zum Gelingen beitragen kann. Es versteht sich von selbst, dass sie die gewünschten Verhaltensänderungen nicht bloss einfordern darf, sondern vorleben muss. Insbesondere muss die Unternehmensleitung jederzeit unbedingten Willen zeigen, den eingeschlagenen Weg nicht ohne Not zu verlassen, sondern bis zum Ende zu gehen.
Kurz: Die Mitarbeiter müssen vom Vorhaben überzeugt sein und dass sie dabei von den richtigen Leuten geführt werden.
Erfolgreiche Unternehmen sind umsetzungsstark. Denn Unternehmen werden an ihren Taten gemessen und an ihren Taten entscheidet sich ihre Zukunft. In diesem Sinne wünschen wir Willensstärke und Ausdauer. Bei Bedarf stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Hofnarren (Oktober 2013)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Dünn sei sie, die Luft an der Spitze. Und sauerstoffarm. Darunter leide denn auch die Denkleistung jener dort oben, wird gerne gewitzelt. Nicht ohne einen Kern Wahrheit: in den Chefetagen findet sich tatsächlich ein erhöhtes Risiko, schlechte Entscheidungen zu treffen.
Die Hauptursachen dafür sind falsche Entscheidungsgrundlagen und Selbstüberschätzung. Falsche Entscheidungsgrundlagen lassen sich auf die Machtfülle der Unternehmensleitung zurückführen. Macht kann bei Untergebenen Angst hervorrufen; Angst vor Fehlern beispielsweise oder Angst, als Überbringer schlechter Nachrichten in Ungnade zu fallen. Um dies zu verhindern werden Informationen gefiltert, verzerrt oder geschönt. Die Gefahr der Selbstüberschätzung hingegen ist dem meist langem Weg zum Erfolg von Unternehmern und Führungskräften zuzuschreiben. Ein oft schon zu Beginn gesundes Selbstbewusstsein wird mit jeder gemeisterten Hürde weiter gestärkt. Problematisch wird es, wenn Realitätsverlust eintritt und jedes positive Ergebnis dem eigenen Können zugeschrieben wird.
Was tun gegen Isolation und Selbstüberschätzung? Mittelalterliche Herrscher hielten sich Hofnarren. Diese hatten die Aufgabe, ihrem Monarchen die Wahrheit zu sagen und ihn an seine Endlichkeit zu erinnern und somit für Demut zu sorgen.
Kritische Stimmen sollten auch heutzutage an der Unternehmensspitze nicht fehlen. Darum gilt es, eine offene und angstfreie Kommunikationskultur zu etablieren und eine gesunde Skepsis gegenüber allem zu erlauben, was nach Übermut und Selbstgefälligkeit aussieht.
Hierzu eignen sich persönliche Feedbacks von Freunden, Familienmitgliedern oder professionellen Coaches. Ebenso dürfen Rückmeldungen von Kollegen, Untergebenen oder Kunden nicht fehlen, zum Beispiel mittels fest etablierter, regelmässiger Feedbackrunden. Schliesslich braucht es auf der obersten Führungsebene vor allem den Willen, Kritik zuzulassen und die Grösse, das eigene Tun in Frage zu stellen.
Queen Elizabeth I soll einst einen ihrer Hofnarren getadelt haben, weil er mit ihr nicht streng genug gewesen sei. Sie regierte 45 Jahre und starb eines natürlichen Todes – eine bemerkenswert lange Regentschaft in einer Zeit, als auch adlige Köpfe schneller rollten als Herbstblätter von den Bäumen fallen.
Kluge Führungskräfte sind sich der Gefahren durch mangelhafte Information und Überheblichkeit bewusst und sie wissen sich und ihre Unternehmung davor zu schützen. In diesem Sinne wünschen wir ein offenes, ehrliches Umfeld und eine gesunde Prise Selbstzweifel. Bei Bedarf stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Die drei Säulen der strategischen Analyse (August 2013)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Entscheidungen über die künftige strategische Ausrichtung einer Unternehmung haben weitreichende Auswirkungen. Sie binden Ressourcen für lange Zeit und lassen sich im Bedarfsfall nur schwer korrigieren. Umso wichtiger ist es daher, dass sie sich auf eine sorgfältige Analyse der Ausgangslage (strategische Analyse) abstützen. Diese sollte aus folgenden drei Säulen bestehen: Umwelt-, Unternehmens- und Eigentümeranalyse.
Aufgabe der Umweltanalyse ist es, alle externen Entwicklungen zu erfassen, die in Zukunft für die Unternehmung von Bedeutung sein könnten. So sind für einen lokalen Bierbrauer unter anderem die zunehmende Präferenz der Konsumenten für regionale Produkte oder die steigende Anzahl Kleinbrauereien in unmittelbarer Nähe von Interesse.
Es empfiehlt sich, systematisch vorzugehen und ein bestehendes Raster zu verwenden, wie es zum Beispiel das St. Galler Management-Modell anbietet. Zudem sollten möglichst viele unterschiedliche Quellen wie Studienresultate, eigene Erhebungen, Interviews oder Expertenmeinungen genutzt werden, um ein umfassendes Bild zu erhalten.
Aufgabe der Unternehmensanalyse ist es, die Stärken und Schwächen der Unternehmung herauszuschälen. Welche Eigenschaften dabei von Bedeutung und wie diese zu beurteilen sind, hängt ausschliesslich von den relevanten Anspruchsgruppen (Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten etc.) und deren Erwartungen ab. Während Kunden einer Hamburgerkette auf rasche Bedienung Wert legen, stehen bei den Gästen eines Gourmetrestaurants Raffinesse und Kreativität der Küche im Vordergrund. Die wichtigsten Erkenntnisse stammen deshalb aus Befragungen und Beobachtungen dieser Anspruchsgruppen. Wir warnen hingegen vor unreflektierten Vergleichen mit der Konkurrenz, wie sie in diesem Zusammenhang immer wieder anzutreffen sind. Die ungenügende Serviceleistung einer Telefongesellschaft bleibt in den Augen der Kunden auch dann ungenügend, wenn sie besser abschneidet als jene anderer Anbieter.
Aufgabe der Eigentümeranalyse ist es, die Wertvorstellungen, Ziele und Wünsche der Eigentümer und der massgeblichen Kreditgeber zu ermitteln. Denn sie grenzen den Spielraum für die Entwicklung der neuen Strategie in der Regel zusätzlich ein. So kann die Besitzerfamilie einer mittelgrossen Maschinenbaufirma festlegen, dass die Produktionsstandorte in der Schweiz nicht aufgegeben werden dürfen. Oder eine Bank kann die Finanzierung eines Expansionsschrittes an Bedingungen knüpfen, welche die Attraktivität dieser Option deutlich verringern. Ausserdem sind es letztlich die Eigentümer, welche die Strategie verabschieden und in erster Linie die Risiken tragen. Interviews und Gespräche mit den Inhabern und deren Umfeld, gegebenenfalls mit den wichtigsten Kreditgebern, sind daher primäre Informationsquellen.
Diese drei Pfeiler verleihen dem strategischen Gebäude die notwendige Stabilität. Darum sollten für deren Errichtung genügend Zeit, Geld und Expertise bereitgestellt werden. In diesem Sinne wünschen wir den richtigen Fokus. Bei Bedarf stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Shareholder Value - Versuch einer Ehrenrettung (Mai 2013)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Der Begriff Shareholder Value hat einen schlechten Ruf. In Medien und Politik wird er oft mit kurzfristiger Gewinnmaximierung gleichgesetzt, die sich einzig und allein an Aktionärsinteressen orientiert und deren negative Folgen während der Finanzkrise überdeutlich hervortraten. Dabei ist das ursprüngliche Konzept hinter dem Begriff weder auf schnellen Gewinn noch einseitig auf die Aktionäre ausgerichtet.
Das Konzept wurde von Alfred Rappaport entwickelt und durch sein 1986 erschienenes Buch "Creating Sharholder Value" weltweit bekannt. Es geht darum, dass unternehmerische Aktivitäten letztlich für die Eigentümer, sprich Shareholder, finanziellen Wert schaffen müssen. Zur Berechnung des Werts schlägt Rappaport ein Verfahren vor, das auf Discounted Cash Flows beruht, die State of the Art-Methode bei der Beurteilung von Investitionen.
Der Unternehmenswert für die Eigentümer resultiert dabei aus der Summe aller künftigen Discounted Free Cash Flows, abzüglich des Fremdkapitals (Schulden). Free Cash Flows können hier in einer sehr groben Annäherung mit Gewinnen nach Abzug der notwendigen Investitionen gleichgesetzt werden. Discounted heisst, dass Gewinne, die weiter in der Zukunft liegen weniger stark gewichtet werden als zeitnah erwartete Gewinne. Die Grundformel der Berechnung arbeitet mit der sogenannten ewigen Rente, die von einer unendlichen Lebensdauer der Unternehmung ausgeht. Einen langfristigeren Zeithorizont könnte das Konzept somit gar nicht haben.
Nachhaltig positive Cash Flows kann nur generieren, wer sich erfolgreich im Markt positioniert, seine Kunden und ihre Bedürfnisse gut kennt und ihnen mit überdurchschnittlichen Angeboten begegnet. Auf Dauer gelingt dies nur mit motivierten Mitarbeitern und hervorragenden Partnern, wie Lieferanten, Händlern oder Logistikunternehmen. Deren Interessen, aber auch jene aller anderen relevanten Anspruchsträger, der Stakeholder, wie beispielsweise dem Staat, der Öffentlichkeit oder NGOs müssen daher in die unternehmerischen Entscheidungen einbezogen werden. Der Shareholder-Ansatz verlangt also unbedingt nach Berücksichtigung aller Stakeholder und ist damit alles andere als eindimensional.
Dass der Shareholder Value im Lauf der Zeit mit ganz anderen Inhalten in Verbindung gebracht wurde, liegt nach Ansicht seines Begründers hauptsächlich an Fondsmanagern und Vorständen, die ihn als Deckmantel für eigene, kurzfristige Interessen missbrauchten. Oder wie er an anderer Stelle schreibt: "The reality is that the shareholder value principle has not failed management; rather, it is management that has betrayed the principle". Derart in Verruf geraten wird der Begriff heute vielfach durch Value Based Management oder Value Based View ersetzt.
Unter welchem Namen auch immer, erfolgreiche Unternehmen schaffen nachhaltigen Wert für Ihre Eigentümer. Sie erreichen dies, indem sie mit einem langfristigen Zeithorizont operieren und auch für ihre Stakeholder Werte schaffen. In diesem Sinne wünschen wir Weitsicht und gutes Beziehungsmanagement. Bei Bedarf stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Das Haus in Schuss halten (Februar 2013)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Herr Rossi, ein Freund meines Vaters, besass einst ein kleines Haus in Norditalien. Er pflegte es vorbildlich, führte notwendige Renovationen unverzüglich aus und hielt es so in einwandfreiem Zustand. Als er vor einigen Jahren beschloss, das Häuschen zu verkaufen, reichte es, einige Möbel zu entfernen, die Räume gründlich zu reinigen und den Garten herzurichten, um ein wahres Bijoux auf den Markt bringen. Trotz Finanzkrise fand es rasch einen Käufer und erzielte einen guten Preis.
Gute Wartung erleichtert den Verkauf und steigert den Verkaufspreis. Eine simple und einleuchtende Feststellung wenn es um Häuser, Autos oder Uhren geht. Eigentlich nahe liegend, dass dasselbe auch für Unternehmungen gilt. Dennoch unterlassen es Unternehmer häufig, ihre Firma rechtzeitig für einen späteren Verkauf oder die Übergabe an einen Nachfolger in Form zu bringen. Ist es dann soweit, liegen die Gebote weit unter den Erwartungen oder es finden sich überhaupt keine Interessenten.
Wie beim Hausverkauf beeinflussen zwei grundlegende Aspekte die Marktchancen positiv:
Zum einen muss das Objekt dem Käufer attraktiv und viel versprechend erscheinen. Die Vergangenheitszahlen sollten gesund, das Unternehmen insgesamt robust und entwicklungsfähig wirken.
Zum anderen sollten sich mit der Übernahme verbundene Risiken als möglichst klein, überschau- und bewältigbar präsentieren. Das Geschäftsmodell sollte nachvollziehbar und übersichtlich gestaltet sein. Und: es sollte weitgehend unabhängig von der Person des Unternehmers funktionieren.
Konkrete Massnamen, um diesen Zustand zu erreichen, bestehen beispielsweise darin, sich auf gewinnbringende Produkte oder solche mit grossem Potential zu konzentrieren, besonders interessante Kundensegmente und Märkte zu entwickeln, die Organisation logisch und einfach zu gestalten, nicht betriebsnotwendige Unternehmensteile abzuspalten (z.B. Grundstücke) oder Know-how vom Unternehmer in die Unternehmung zu transferieren.
Diese Massnahmen brauchen Zeit. Sie müssen daher frühzeitig eingeleitet werden. Ein einmaliger Effort verpufft wirkungslos. Wie bei einem Gebäude ist die Wartung einer Firma eine fortwährende Aufgabe.
Erfolgreiche Unternehmer halten ihr Haus in Schuss. Dadurch bleibt es für allfällige Nachfolger attraktiv. Das stärkt die eigene Verhandlungsposition und hält alle Optionen offen. In diesem Sinne wünschen wir gute Instandhaltung und stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Gestalten statt erdulden (September 2012)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Es war einmal ein Fussballtrainer, der die Schuld für jedes verlorene Spiel beim Schiedsrichter suchte. Einmal war es ein völlig ungerechtfertigter Elfmeter gegen, ein anderes Mal ein nicht gegebener Penalty für sein Team, wieder ein anderes Mal ein komplett unverständlicher Platzverweis, der seine Mannschaft scheitern liess. Gab es ausnahmsweise nichts gegen den Schiri einzuwenden, fand er andere böse Mächte, die sich gegen ihn und die Seinen verschworen hatten: eine rekordverdächtig hohe Anzahl Fehlpässe oder ein unglaubliches Abschlusspech gingen dann allein auf deren Konto.
Zusammengefasst lautete seine Botschaft: "Wir waren gut, aber die Welt ist ungerecht. Dagegen sind wir machtlos. Sobald die Welt sich ändert, finden wir zum Erfolg zurück." Obwohl die Frustration mit jedem Rückschlag wuchs, machten Trainer und Spieler weiter wie bisher - es gab ja keinen Grund am Training, der Spielweise oder gar der Einstellung Anpassungen vorzunehmen. Es kam, wie es kommen musste: Die Niederlagen häuften sich und die Mannschaft stieg sang- und klanglos ab. Und wenn es keinen Trainerwechsel gegeben hat, dann kicken sie noch heute erfolglos vor sich hin.
Viele Entwicklungen, die uns betreffen, entziehen sich unserem Einfluss. Trotzdem verfügen wir (fast) immer auch über Gestaltungsmöglichkeiten. Aus dem Bewusstsein bis zu einem gewissen Grad Herr unseres Schicksals zu sein, schöpfen wir schliesslich Inspiration, Kraft und Durchhaltewillen. Die Aufgabe des Trainers wäre es gewesen, aufzuzeigen, wie die Spieler ihr Los selbst in widrigen Situationen beeinflussen können. Er hätte ihnen beispielsweise mitgeben können, sich bei strengen Schiedsrichtern besonders fair zu verhalten und im eigenen Strafraum Berührungen des Gegners zu vermeiden. Oder er hätte ihnen klarmachen können, dass höhere Laufbereitschaft zu mehr Torchancen führt, wodurch sich allfälliges Abschlusspech kompensieren liesse. Damit hätte er nicht zuletzt für die richtige Einstellung und das nötige Selbstvertrauen gesorgt.
Erfolgreiche Unternehmer und Manager konzentrieren sich vor allem in schwierigen Zeiten auf die Frage "was können wir selber tun?" und kommunizieren diese Haltung auch nach innen. Damit sichern sie sich die Motivation und das Engagement ihrer Mitarbeiter. In diesem Sinne wünschen wir einen geschärften Blick für die eigenen Gestaltungsmöglichkeiten und stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Sturmvögel (September 2012)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Die Eurokrise hat uns fest im Griff. Auch wenn sich die Schweiz bisher als ziemlich resistent erwiesen hat, verdanken etliche Unternehmungen ihr Überleben der Schweizerischen Nationalbank, die mit massiven Interventionen den Schweizerfranken stützt. Sie, wie viele andere, hoffen nun, diese schwierige Zeit einigermassen unbeschadet zu überstehen.
Doch was ist, wenn auf diesen Sturm gleich der nächste folgt, wenn kaum Zeit zum Verschnaufen bleibt, wenn die vermeintliche Ausnahmesituation zur Regel wird? Schliesslich waren bereits die letzten 15 Jahre geprägt von immer neuen Verwerfungen (Asienkrise, Platzen der Internetblase, 9/11 und die Folgen, Immobilien-, Finanz- und Eurokrise). Welche Eigenschaften müssten Unternehmungen aufweisen, um auch in einem solchen Umfeld langfristig erfolgreich zu bleiben?
Diese Unternehmungen werden neue Wege finden müssen, um mit den ständigen, heftigen Auf und Abs umzugehen. Sie müssen in der Lage sein, in kurzer Abfolge völlig neue Herausforderungen zu meistern. Dabei werden Themen wie "wachsen/ schrumpfen", "bisherige Märkte verlassen/in neue Märkte vorstossen", "Rückschläge verdauen/Stärken aufbauen", "Risiken minimieren/Chancen ergreifen" dominieren. Anpassungsfähigkeit und -geschwindigkeit, gepaart mit einer gewissen Robustheit dürften zu entscheidenden Erfolgsfaktoren werden. Die grosse Kunst wird darin bestehen, unter massivem Druck die richtigen Lösungen zu finden und umzusetzen.
Diejenigen, denen dies besonders gut gelingen könnte, bezeichnen wir als Sturmvögel. Im Tierreich gelten Sturmvögel als ausgezeichnete Flieger, die unter anderem in der Lage sind, sich schwersten Wetterbedingungen anzupassen.
Stellt sich nun die Frage, welche spezifischen Merkmale Unternehmungen als Sturmvögel auszeichnen: Wie legen sie beispielsweise ihre Strategie fest? Wie definieren sie ihre Zielkunden und ihr Angebot? Wie gestalten sie Prozesse, Strukturen und Instrumente? Weist ihr Führungsverhalten oder ihre Unternehmenskultur besondere Eigenheiten auf? Stehen bestimmte Werte im Vordergrund? Wie sieht ihre Finanzpolitik aus? Gibt es konkrete Beispiele solcher Unternehmungen und wenn ja, was können wir von ihnen lernen?
In einem durchaus möglichen Szenario andauernder Krisen gewinnt die Beantwortung dieser Fragen grosse Bedeutung. Wir haben daher beschlossen, den Eigenschaften der Sturmvögel einen Schwerpunkt in Research und Beratung zu widmen und in unregelmässigen Abständen in unserem Newsletter darüber zu berichten. In der Zwischenzeit wünschen wir allen einen schönen Sommer und stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Risikomanagement - mehr tun als verlangt (April 2012)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Würden Sie minutiös Ferien planen, um dann ohne zwingenden Grund zu Hause zu bleiben? Oder über Monate einen Marathon vorbereiten, um schliesslich doch nicht anzutreten? Sie werden zu Recht antworten, dass es sinnlos wäre, so viel Arbeit in ein Unterfangen zu stecken, welches man nicht zu Ende führt. Doch genau das tun viele KMUs in Sachen Risikomanagement: Sie bleiben auf halbem Weg stehen.
Seit dem 1.1.2007 verlangt das Obligationenrecht für Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung Angaben zur Durchführung einer Risikobeurteilung. Alle Unternehmungen mit entsprechender Rechtsform versuchen seither die Risiken, denen sie ausgesetzt sind, zu identifizieren und sie nach Eintretenswahrscheinlichkeit und Schadenhöhe zu klassifizieren. In der Regel resultiert daraus eine Risikoübersicht, welche von den vernachlässigbaren über die relevanten bis hin zu den existenzgefährdenden Risiken reicht. Dabei lassen es die meisten KMUs bewenden, statt aus den gewonnenen Erkenntnissen Konsequenzen zu ziehen. Für den Umgang mit den einzelnen Risiken werden keine Massnahmen definiert (vermeiden, verringern, versichern, selbst tragen) und demzufolge auch nicht umgesetzt. Die Risiken sind nun zwar bekannt, sie werden aber nicht aktiv und systematisch bewirtschaftet.
Dadurch wird wohl dem Buchstaben des Gesetzes Genüge getan, der Nutzen für die Unternehmung bleibt aber vergleichsweise klein. Das ist besonders schade, weil basierend auf den geleisteten Vorarbeiten ein entscheidender Entwicklungsschritt hin zu grösserer Stabilität des Geschäftes getan werden könnte. Zudem kann das Wissen um nicht gesteuerte Risiken für einige Unternehmer ein Hemmnis darstellen. Wagnisse geht man schliesslich leichteren Herzens ein, wenn man die Gefahren erst gar nicht kennt - oder aber, wenn man diese bereits einkalkuliert hat: In meiner Jugend hatte ich einen Turnlehrer, der uns Schülern im Geräteturnen Übungen beibrachte, die wir uns niemals zugetraut hätten. Sein Trick bestand darin, beim Vorzeigen einer neuen Übung zu erklären, wie diese bei Misslingen jederzeit sicher abgebrochen werden konnte. Dadurch erlangten wir die nötige Lockerheit und das Vertrauen, uns an Schwieriges heranzuwagen.
KMUs sollten den grösstmöglichen Nutzen aus den gesetzlichen Vorschriften ziehen und Risikomanagement nicht als lästige Pflicht, sondern als Entwicklungschance betrachten. In diesem Sinne empfehlen wir, den Weg zu Ende zu gehen und stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Hypothesen überprüfen (Februar 2012)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Zwei Jahre ist es her. Ich kam an einem Winterabend nach Hause und entdeckte Erdkrümel auf dem Fussboden. Dann fielen mir die offenen Schranktüren im Schlafzimmer auf und die trotz Kälte sperrangelweit geöffnete Balkontür. Ich pflege Balkon- und Schranktüren zu schliessen, bevor ich morgens aus dem Haus gehe und schmutzige Schuhe bleiben normalerweise draussen. Trotzdem war ich eine ganze Weile davon überzeugt, frühmorgens - noch leicht schläfrig vielleicht und in Eile - die üblichen Handgriffe vergessen und den Schmutz irgendwie selber verursacht zu haben. Erst als ich am Boden verstreute Holzsplitter bemerkte, konnte ich mich der Tatsache nicht länger verschliessen: Bei mir war eingebrochen worden.
Dieses Erlebnis verdeutlicht drei Dinge:
-
Wir alle bauen uns Modelle der Realität. Diese enthalten Hypothesen, wie die Dinge sind und wie sie sich verhalten.
In meiner Realität verschaffen sich beispielsweise keine fremden Menschen Zugang zu meiner Wohnung. -
Wir neigen dazu, nur Informationen zu berücksichtigen, die unsere Hypothesen stützen. Wiedersprechende Informationen ignorieren wir dagegen gerne oder biegen sie so zu recht, dass sie in unser Weltbild passen. Oft sind wir erst dann gewillt, unser Modell zu überdenken, wenn offenkundige Unstimmigkeiten nicht mehr negiert werden können.
Die frühmorgendliche Verwirrtheit lieferte eine plausible Erklärung innerhalb meines Modelles. Bloss die Holzsplitter liessen sich damit nicht mehr in Einklang bringen. -
Obiges Verhaltensmuster hat durchaus seine Berechtigung. Indem wir nicht ständig alles von neuem in Frage stellen, können wir im Alltag schnell und reibungslos funktionieren. Es wird dann problematisch, wenn unsere Gedankenmodelle und die Realität zu weit auseinanderklaffen und wir unser Verhalten nicht rechtzeitig anpassen.
Stellen Sie sich vor, die Einbrecher hätten sich noch in meiner Wohnung aufgehalten. Ich hätte sie auf keinen Fall antreffen wollen. Dazu hätte ich allerdings, bereits vom Schmutz alarmiert, die Wohnung unverzüglich verlassen müssen.
Gedankenmodelle und Arbeitshypothesen sind auch in Unternehmungen die Basis vieler Entscheidungen. Grösste Bedeutung kommt ihnen auf strategischer Ebene zu, bilden sie hier doch das Fundament der künftigen Ausrichtung einer Unternehmung. Wenn die Strategie in einem strukturierten Prozess formuliert wird, dann werden die grundlegenden Annahmen, beispielsweise zur allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklung oder zu Veränderungen des Kundenverhaltens, in der Regel klar deklariert. In Unternehmungen ohne explizite Strategie sind diese hingegen nicht immer evident. Oft ist man sich ihrer nicht einmal intern bewusst. Implizit wird jedoch angenommen, dass alles so weiter geht wie bisher.
Um vor bösen Überraschungen gefeit zu sein, aber auch um sich bietende Chancen rechtzeitig zu erkennen, sollten gerade bei strategischen Fragen die wichtigsten Hypothesen regelmässig überprüft werden. Weil wir dazu neigen, Hypothesen zu bestätigen, ist zur Überprüfung derselben gezielt nach widerlegenden Fakten zu suchen. Lassen sich solche finden, muss die Strategie grundsätzlich überdacht werden. Ist dies nicht der Fall, gewinnt das Modell an Robustheit und die Unternehmung an Sicherheit. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen einen kritischen und wachen Geist. Bei Bedarf stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Walk The Talk (November 2011)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Am Tag seiner Freilassung im Jahr 1990 leitete Nelson Mandela in einer Rede öffentlich seine Politik der Versöhnung ein, indem er zur Mitarbeit an einem nichtrassistischen, geeinten und demokratischen Südafrika einlud. Dies, nachdem er unter dem Apartheidregime 27 Jahre im Gefängnis verbracht hatte.
Mandela liess den Worten Taten folgen: Als er 1994 zum ersten schwarzen Präsidenten des Landes gewählt wurde, ernannte er seinen weissen Vorgänger, Frederik Willem de Klerk, zu seinem Stellvertreter. Die Herzen vieler weisser Südafrikaner eroberte er schliesslich, als er sich 1995 zum Rugby World-Cup-Final im grünen Jersey der südafrikanischen Nationalmannschaft einfand. Rugby war bis dahin ein fast ausschliesslich weisser Sport und ein Symbol der weissen Herrschaft gewesen.
Auch Unternehmungen durchlaufen Veränderungsprozesse. In der heutigen, schnelllebigen Zeit sogar immer häufiger und schneller. Entweder steht dabei proaktives, gestalterisches Wirken im Vordergrund - zum Beispiel dann, wenn neue Dienstleistungen angeboten werden sollen und die Abläufe entsprechend zu modifizieren sind - oder die Anpassungen erfolgen reaktiv aufgrund von veränderten äusseren Gegebenheiten - beispielsweise wenn systemrelevante Banken ihre Strukturen und Prozesse den kommenden "Too big to fail"-Regulierungen anpassen müssen.
Selbstverständlich lassen sich diese Veränderungen hinsichtlich Tragweite und Gefahrenpotential nicht mit der Transformation Südafrikas vergleichen. Das Gelingen eines Umgestaltungsprozesses kann jedoch den Erfolg der Unternehmung wesentlich beeinflussen; mitunter so weit, dass deren Fortbestehen unmittelbar davon abhängt. Als aktuelles Beispiel kann hierzu der Mobiltelefon-Hersteller Nokia erwähnt werden, der mit einer Neuausrichtung ums Überleben kämpft.
Wie gut, wie rasch und wie nachhaltig Veränderungen umgesetzt werden, hängt unserer Erfahrung nach ganz entscheidend von den involvierten Führungskräften ab. "Walk the talk" - selbst tun, was man predigt - ist dabei einer der wichtigsten Grundsätze, der leider viel zu häufig nicht beherzigt wird. Wer Mitarbeitern neue Regeln und Verhaltensweisen vorgibt, diese aber selbst nicht vorlebt, wird unweigerlich auf Widerstände und stille Sabotage stossen. Ein schleichender Rückfall in alte Muster ist die Folge. Ironischerweise werden Führungskräfte so zu Totengräbern ihrer eigenen Projekte.
Entgegen vielen Befürchtungen verlief der historische Umbruch Südafrikas friedlich und unblutig, nicht zuletzt dank Mandelas glaubwürdig vorgelebten Beispiels. Gute Führungskräfte wissen, dass sie unter besonderer Beobachtung stehen und setzen ihre Vorbildfunktion bewusst und erfolgreich für Veränderungen ein. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen gutes Gelingen und stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Der Preis eines Brotes hat nichts mit seinem Kosten zu tun (September 2011)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Würden Sie für ein Brot der Bäckerei Müller das Doppelte bezahlen wie für ein vergleichbares Brot der Bäckerei Meier nebenan? Wahrscheinlich nicht.
Würde es Ihre Entscheidung beeinflussen, wenn Ihnen Bäcker Müller erklären würde, er habe eben einen grossen Ausschuss und dadurch auch hohe Kosten? Wohl kaum.
Nach diesen rhetorischen Fragen mag dies zwar erstaunen, doch erleben wir immer wieder, dass Preis und Kosten nicht sauber auseinander gehalten werden, selbst von gestandenen Unternehmern.
Der Preis ist in einem marktwirtschaftlichen System das Resultat von Angebot und Nachfrage. Der einzelne Anbieter kann dabei den Preis seines Produktes nur innerhalb bestimmter Grenzen selber gestalten, wenn er konkurrenzfähig bleiben will.
Die Kosten hingegen entsprechen dem in Franken ausgedrückten Input an Arbeit, Know-how, Material und Realkapital wie Boden, Gebäude und Maschinen, um ein Produkt herzustellen. Hier besitzt der Unternehmer direktere Einflussmöglichkeiten.
Preis und Kosten haben also grundsätzlich nichts miteinander zu tun. Insbesondere ist der Preis keine Funktion der Kosten, auch wenn sich der eine oder andere Unternehmer dies manchmal wünschen würde. Die einzig gültige, wenn auch triviale Aussage dazu ist, dass die erzielten Preise langfristig höher liegen müssen als die Kosten.
Was heisst das nun für Bäcker Müller? Er hat prinzipiell zwei Ansatzmöglichkeiten, um seine Situation zu verbessern.
Einerseits kann er darauf hin arbeiten, seine Kosten zu reduzieren. Dass er hierbei als erstes seinen Produktionsprozess verbessern und den Ausschuss verringern muss, wird ihm auch sein Lehrling sagen können.
Andererseits kann er durchaus versuchen, höhere Preise zu erzielen als sein Konkurrent. Dazu muss die Kundschaft sein Angebot allerdings auch als höherwertig einstufen. Das kann er erreichen, indem er beispielsweise bessere Zutaten verwendet, seine Kunden besonders freundlich bedient oder neue, ansprechende Brotformen einführt. Nicht jede Massnahme ist zwingend mit höheren Kosten verbunden, wie diese Beispiele deutlich zeigen.
Erfolgreiche Unternehmen unterscheiden klar zwischen Preis und Kosten. Das entspricht nicht nur der Logik der Sache, sondern ermöglicht insbesondere die Formulierung spezifischer Ziele und entsprechender Aktionen. In diesem Sinne empfehlen wir ein differenziertes Vorgehen und stehen bei Bedarf jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Standardprozesse sichern (Juni 2011)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
In unserem Februarnewsletter haben wir uns für Standardprozesse ausgesprochen. Ein Leser stellte daraufhin die berechtigte Frage, wie deren Einhaltung denn gesichert werden könne. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten:
Exakt definierte Abläufe wie die Onlinebestellung von Waren oder die Fliessbandproduktion von Fahrzeugen lassen sich mit Hilfe von Informatik oder Robotik fixieren. Der Mensch muss sich dabei an strikte Vorgaben ohne Spielraum halten.
Abläufe hingegen, die menschliche Urteilskraft oder Geschicklichkeit erfordern, lassen sich nicht automatisieren. In diesem Fall kann das Befolgen der Vorgaben permanent, regelmässig oder stichprobenweise kontrolliert werden. Eine Massnahme, die jedoch mit Kosten verbunden ist und die Gefahr birgt, Mitarbeiter durch die Überwachung zu demotivieren.
In Bereichen mit besonders hohen Sicherheitsanforderungen sind strikte Kontrollen allerdings unabdingbar. So werden beispielsweise kritische Wartungsarbeiten in der Luftfahrtindustrie nach dem Vier-Augen-Prinzip durchgeführt und oft gar mehrfach nachgeprüft.
Ist eine Automatisierung nicht möglich und geht es nicht um maximale Sicherheit, dann gibt es einen weiteren Ansatz, der unserer Ansicht nach wesentlich kostengünstiger und vielversprechender ist. Hierbei steht die Sinnhaftigkeit des eigenen Tuns im Vordergrund. Wenn für die ausführenden Personen der Zweck und die Logik eines Prozesses sowie die Bedeutung ihres Beitrages klar ersichtlich sind, dann werden sie ihre Aufgaben engagiert, einwandfrei und mit Befriedigung erfüllen.
Ein schönes Beispiel hierfür ist die erste Mannschaft des FC Barcelona mit ihrem einzigartigen Stil. Der Ball zirkuliert schnell und höchst präzise. Positionen, Laufwege und Passmöglichkeiten sind exakt aufeinander abgestimmt. Die Spieler wissen in jeder Situation, was sie zu tun haben und erfüllen ihre Rollen diszipliniert und mit Leidenschaft. Dies ist nicht nur das Resultat unzähliger Wiederholungen im Training, sondern rührt insbesondere auch daher, dass jeder einzelne von der Richtigkeit der Spielweise überzeugt ist. Erst letzteres macht aus einer Ansammlung von Meistern ihres Fachs ein unschlagbares Kollektiv.
Erfolgreiche Unternehmungen wissen um die Wirkung sinnstiftender Arbeit auf die Motivation ihrer Angestellten und berücksichtigen diese auch bei der Gestaltung ihrer Prozesse. Damit sichern sie schliesslich auch deren Einhaltung. In diesem Sinne wünschen wir Weitsicht und Vertrauen. Bei Bedarf stehen wir gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Peacekeeper (Mai 2011)
Der Nutzen einer internen Bewertung
Liebe Kunden, Partner und Freunde
In Unternehmungen, die sich in den Händen von wenigen Partnern befinden besteht häufig der Wille, die Grundzüge der Zusammenarbeit im Voraus festzulegen. Zudem soll auch das Vorgehen beim Eintreten genau definierter Situationen im vornhinein bestimmt werden. Dabei geht es darum, künftige Streitigkeiten möglichst zu vermeiden. Als Instrumente eignen sich dazu je nach Gesellschaftsform Statuten, Aktionärsbindungsverträge und Gesellschafterverträge.
Inhaltlich können hierbei unter anderem die Grundstrategie, Finanzierungsgrundsätze, das Recht auf Einsitz in die Geschäftsleitung, Entscheidungsregeln, gegenseitige Informationspflichten und Konkurrenzverbote festgeschrieben werden. Ausserdem kann bestimmt werden, wie beim Ausscheiden von Gesellschaftern, bei der Abtretung von Anteilen oder im Fall von Tod, Scheidung, Handlungsunfähigkeit oder Zwangsvollstreckung eines Gesellschafters vorzugehen ist. Üblicherweise werden diese Fragen mittels Angebotspflichten seitens der ausscheidenden oder verkaufswilligen Partner bzw. mittels Kaufrechten der verbleibenden Partner gelöst.
Der Bestimmung des Wertes der zu übertragenden Anteile kommt dabei eine zentrale Bedeutung zu. Dennoch werden häufig keine konkreten Vereinbarungen getroffen, wie dieser Wert bestimmt werden soll. Wenn es dann drauf ankommt, ist der Streit vorprogrammiert. Das Delegieren dieser Aufgabe an eine externe Stelle, beispielsweise an eine Treuhandgesellschaft, verlagert das Problem lediglich. Wir empfehlen deshalb, eine einfache und für alle Partner nachvollziehbare Formel zur Bestimmung des Wertes in die Vertragswerke aufzunehmen. Der Nutzen für die Gesellschafter liegt auf der Hand: Sie können die möglichen finanziellen Konsequenzen bestimmter Ereignisse genauer abschätzen und sich besser darauf vorbereiten.
"Wer streiten will, findet immer einen Grund." Dieser häufig gehörte Einwand ist nicht falsch. Aber mit einer gemeinsam festgelegten Wertbestimmungsformel verringert sich die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Streitigkeiten kommt. In diesem Sinne wünschen wir ausschliesslich fruchtbare Auseinandersetzungen und stehen bei Bedarf jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Ein Plädoyer für Standardprozesse (Februar 2011)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
In jeder Unternehmung fällt eine mehr oder weniger grosse Anzahl häufig wiederkehrender, gleichartiger Aufgaben an: Offerten werden erstellt, Bestellungen abgewickelt, Waren geliefert, Leistungen fakturiert und Löhne bezahlt. Die meisten Firmen standardisieren und optimieren die Abläufe zur Bewältigung derartiger Aufgaben. Doch insbesondere KMUs klagen öfters, dies führe zu unerwünschter Gleichmacherei, ersticke die Kreativität der Mitarbeiter und beanspruche unnötig viel Zeit, die man besser für anderes aufwenden würde.
Dabei ist das Gegenteil der Fall:
Standardisierte Prozesse, die konsequent auf Kundenbedürfnisse ausgerichtet sind, sichern eine konstant hohe Qualität von Produkten und Dienstleistungen. Dadurch steigt die Kundenzufriedenheit und das Profil der Unternehmung wird geschärft.
Standardisierte Prozesse zur Erfüllung immergleicher Aufgaben setzen Ressourcen frei. Kreativität kann dort entfaltet werden, wo sie den grössten Nutzen stiftet; das Rad muss nicht jedes Mal neu erfunden werden.
Standardisierte Prozesse helfen überdies Kosten zu senken. Doppelspurigkeiten können beseitigt, Durchlaufzeiten verkürzt und Fehlerhäufigkeiten reduziert werden.
Beispiele? Standardisierte Abläufe helfen uns morgens pünktlich zur Arbeit zu erscheinen, geben Musikern Raum zur Improvisation, ermöglichen es Kellnern trotz Hektik ihren Gästen die volle Aufmerksamkeit zu schenken und bringen Flugzeuge sicher auf den Boden.
Jeder einzelne von uns greift täglich auf standardisierte Abläufe zurück. Auch aufstrebende Kleinbetriebe verfügen implizit sehr wohl über Standardprozesse, selbst wenn diese nicht als solche wahrgenommen werden. Übersicht und kurze Kommunikationswege machen deren formale Ausgestaltung jedoch überflüssig. Erst mit dem Wachstum und der damit verbundenen Arbeitsteilung werden explizite Prozessdefinitionen früher oder später unumgänglich.
Erfolgreiche Unternehmungen legen nicht umsonst grossen Wert auf eine sorgfältige Ausgestaltung ihrer Prozesse. In diesem Sinne wünschen wir die nötige Klarsicht und stehen bei Bedarf gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Weiter denken (Oktober 2010)
Bei einer Branchenanalyse Grenzen sprengen
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Die anfangs Oktober in Brasilien abgehaltene Wahl um die Nachfolge Luiz Inácio Lula da Silvas endete mit einer Überraschung. Allgemein war erwartet worden, Lulas Kandidatin Dilma Rousseff würde bereits im ersten Wahlgang den Sieg davon tragen. Die grüne Ex-Umweltministerin Marina Silva verdarb jedoch mit fast 20% der Stimmen das geplante Fest. Mit ihrem Programm war sie von den etablierten Parteien anfänglich nicht beachtet und später nicht ernst genommen worden.
Auch das iPhone von Apple wurde von den angestammten Handyherstellern zunächst unterschätzt, zu Unrecht, wie sich bald herausstellen sollte. Ähnlich verhielt es sich beim Markteintritt von IKEA. Mit radikal anders gestalteten Produkten, Prozessen und Geschäftsmodellen können neue Akteure wie Apple oder IKEA die in einer Branche herrschenden Spielregeln komplett verändern und bisherige Wettbewerber in arge Bedrängnis bringen.
Noch prekärer wird es für etablierte Unternehmen, wenn sie die Entstehung von Substitutionstechnologien verschlafen, welche die bestehende Produkte ablösen und damit der gesamten Branche den Todesstoss versetzen können. Firmen wie IBM, Nixdorf, DEC oder Olympia hatten in den 1980er Jahren mit dem Einzug des Personal Computers hart zu kämpfen oder verschwanden ganz vom Markt.
Dilma Rousseff wird vermutlich mit einem blauen Auge davon kommen und die Stichwahl gegen den zweitplatzierten José Serra gewinnen. Im Gegensatz dazu erhalten Unternehmen oft keine zweite Chance, wenn sie wichtige Entwicklungen verpassen. Sie müssen mit dauerhaften, empfindlichen Marktanteilsverlusten rechnen, bis hin zur akuten Bedrohung ihrer Existenz.
Obwohl also die grössten Gefahren häufig von aussen kommen, konzentrieren sich viele Unternehmungen bei Branchenanalysen auf ihre Mitbewerber, Absatz- und Beschaffungsmärkte. Falsch ist dies nicht, nur sollte der Schwerpunkt anders gesetzt werden.
In einer sich immer schneller wandelnden Umwelt darf die Branchenanalyse nicht bei vermeintlichen Branchengrenzen enden. Im Gegenteil, dort beginnt erst die geistige Pionierarbeit. Rechtzeitiges Erkennen neuer Konkurrenten oder potentieller Substitutionsprodukte kann zur Überlebensfrage werden. Dazu braucht es den Mut und die Phantasie, das Unmögliche zu denken. Es braucht Freiräume, die es erlauben, Szenarien rasch zu entwickeln und ebenso rasch wieder zu verwerfen. Und es braucht das Verständnis, dass die resultierenden Aussagen nur qualitativer Natur sein und bestenfalls mit groben Eintretenswahrscheinlichkeiten versehen werden können. Dafür winkt neben der systematischen Reduktion von Risiken auch die Möglichkeit, neue Marktchancen zu entdecken.
Erfolgreiche Unternehmungen antizipieren wichtige Entwicklungen und ergreifen rechtzeitig entsprechende Massnahmen. Nicht selten initiieren sie gar neue Entwicklungen und setzen damit Standards. In diesem Sinne wünschen wir das richtige Gespür und gutes Gelingen. Bei Bedarf stehen wir selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Beraterverantwortung (Juli 2010)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Kürzlich lernte ich an einer Veranstaltung den sympathischen und erfolgreichen Unternehmer C.K. kennen. Im Verlauf unseres Gesprächs sagte er: "Mich stört, dass Berater keine Verantwortung übernehmen."
Dieser Satz ging mir nicht mehr aus dem Kopf. Ich nehme ihn nun zum Anlass für ein paar Gedanken zum Thema Beraterverantwortung und zum häufig anzutreffenden Misstrauen gegenüber den Vertretern unserer Gilde. Es bleibt zu präzisieren, dass hier von der klassischen Unternehmensberatung die Rede sein soll, die sich grundsätzlich mit Fragen von strategischer Relevanz befasst.
In diesem Kontext werden Berater jeweils dann hinzugezogen, wenn spezifisches Know-how, eine externe Sicht, zusätzliche Ressourcen, fundiertere Entscheidungen oder eine Beschleunigung der Veränderungsprozesse benötigt werden. Der grösste Nutzen für die Auftraggeberin entsteht dabei aus unserer Sicht durch die geschickte Kombination von Beraterexpertise und dem im beratenen Unternehmen vorhandenem Wissen. Aus diesem Grund verfolgen wir einen dezidiert partnerschaftlichen Ansatz.
Berater können - und sollen - Verantwortung für die oben aufgeführten Aufgabenbereiche übernehmen. Deren Umfang ist bei Auftragserteilung zu präzisieren. Es gibt jedoch Aufgaben, für die per Definition die Unternehmensführung verantwortlich ist und die nicht delegiert werden können. Im Wesentlichen gehören dazu das Treffen und Durchsetzen strategischer Entscheidungen, das Vermitteln von Orientierung in Veränderungsprozessen und die Kommunikation, insbesondere die Kommunikation schlechter Nachrichten. Ansonsten sind die Grenzen bei der Aufgabenverteilung fliessend und nur vom Willen der Auftraggeberin abhängig.
Enttäuschungen können dann entstehen, wenn es die Vertragspartner versäumen, den Rahmen der Zusammenarbeit genau abzustecken. Für die Auftraggeberin liegt die grösste Schwierigkeit dabei oft in der deutlichen Formulierung der eigenen Erwartungen, weil in der Regel wenig bis keine Erfahrung mit der Vergabe von Beratungsmandaten vorhanden ist. Wir erachten es deshalb als zentrale Aufgabe, unsere Kunden bereits bei der Auftragsformulierung zu unterstützen und legen grossen Wert auf eine saubere Rollendefinition, die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten klar regelt. Dies liegt im Interesse beider Partner und ist Basis für eine fruchtbare und befriedigende Zusammenarbeit.
In diesem Sinne wünschen wir viel Erfolg und stehen bei Bedarf selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Identifikation und Kritik (Mai 2010)
Welche Mitarbeiter eine Unternehmung weiter bringen
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Im vergangenen November kritisierte Philipp Lahm, Urgestein des FC Bayern und eher für seine bescheidene Art bekannt, nach einer Reihe von Misserfolgen die Vereinsführung in ungewöhnlich scharfen Worten. Bayern München lag damals auf dem 8. Platz und damit hoffnungslos hinter den eigenen Ansprüchen zurück. Die Reaktion der Klubleitung liess nicht lange auf sich warten: Lahm wurde zum Rapport zitiert, musste eine Busse zahlen und sich für seine Äusserungen öffentlich entschuldigen.
Parallelen zum betrieblichen Alltag in vielen Unternehmungen sind unverkennbar: Kritik ist unerwünscht - erst recht, wenn sie laut vorgetragen wird. Viele Vorgesetzte empfinden sie als Störfaktor. Zudem bedroht Kritik ihrer Ansicht nach das Betriebsklima und senkt die Motivation der übrigen Mitarbeiter. Gefordert wird Identifikation mit der Unternehmung, ihren Produkten und Dienstleistungen. Darunter versteht man aber leider oft nicht mehr als unbesehenes Übernehmen von Einschätzungen des Managements und unreflektiertes Umsetzen von Entscheiden.
Diese Vorstellung ist weder zeitgemäss noch effizient. Viele Unternehmungen stehen in einem harten Wettbewerb, in dem es sich niemand leisten kann, das Potential von Mitarbeitern brach liegen zu lassen. Viele Köpfe können viele fruchtbare Ideen generieren und so den Boden für den Erfolg vorbereiten. Die Open-Source-Bewegung oder Apples iPhone-Apps sind beste Beispiele. Identifikation mit der Unternehmung heisst in einem solchen Umfeld, dass sich Mitarbeitende einbringen, Kritik üben und Verbesserungsvorschläge machen dürfen. Auf Seiten der Vorgesetzten erfordert dies zuhören, Diskussionen zulassen und die Bereitschaft, Entscheidungen breiter abzustützen.
Bayern München hat vor wenigen Wochen trotz schwachen Saisonbeginns Meisterschaft und Cup gewonnen. Es lässt sich natürlich nicht feststellen, ob Lahms Äusserungen zum Erfolg beigetragen haben. Dass er in seiner Mannschaft als Fussballer und Persönlichkeit eine zentrale Rolle spielt, ist in Fachkreisen jedoch unbestritten. In der grossen Aufregung um die Kritik an der Klubleitung ging übrigens der vielleicht wichtigste Satz aus Lahms Interview unter: "Mir liegt der FC Bayern am Herzen", hatte er damals gesagt.
Mitarbeiter, welche die eigene Unternehmung kritisieren, tun dies oft gerade weil sie sich mit ihr identifizieren. Dafür riskieren sie gelegentlich auch Sanktionen. Solche Mitarbeiter sind besonders wertvoll. Darum sollten sie gestärkt und nicht bestraft werden. In diesem Sinne wünschen wir Gelassenheit und Weitsicht.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Was mich mein Kinderzimmer über Komplexität lehrte (Februar 2010)
Stetiges Streben nach Einfachheit
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Wie viele andere auch machte ich schon als Kind Bekanntschaft mit dem zweiten thermodynamischen Hauptsatz. Dieser besagt, dass jedes System zu ansteigender Unordnung neigt, auch Entropie genannt. Das System, welches die Theorie so treffend veranschaulichte, war natürlich mein Kinderzimmer.
Ähnliches lässt sich in vielen Unternehmungen beobachten. Analog zur Unordnung in meinem Kinderzimmer scheint sich hierbei die Komplexität ständig zu erhöhen, als wäre es ein Naturgesetz. Dabei stehen am Anfang jeder erfolgreichen Unternehmensgeschichte neben einer bestechenden Idee, einer überzeugenden Dienstleistung oder einem herausragenden Produkt insbesondere auch unkomplizierte Abläufe und einfache Strukturen.
Doch mit dem Erfolg kommt das Wachstum. Mit dem Wachstum steigt die Arbeitsteilung; Spezialisierung und Professionalisierung nehmen zu - der Koordinationsaufwand jedoch ebenso. Ausserdem erfordert eine zunehmend komplexer werdende Umwelt die kontinuierliche Vermehrung und Verfeinerung der betrieblichen Prozesse und Instrumente. Dass sich die Komplexität laufend erhöht, ist bis zu einem gewissen Grad also eine normale und meist notwendige Entwicklung, die jedoch auch mit Gefahren verbunden ist.
Komplexität wird dann gefährlich, wenn die Kundenbedürfnisse aus den Augen verloren werden oder die Kosten aus dem Ruder laufen. Schnell wird dann anstelle von Gewinn Verlust geschrieben, und genauso schnell kann eine Unternehmung in ihrer Existenz bedroht sein.
Nach dem zweiten thermodynamischen Hauptsatz kann die Entropie eines Systems nur durch hinzufügen von Energie beziehungsweise Arbeit reduziert werden. Ich musste mein Zimmer von Zeit zu Zeit aufräumen, damit es bewohn- und bespielbar blieb. Das erforderte Energie. Meine Mutter sorgte mit Nachdruck dafür, dass ich diese regelmässig aufbrachte.
Dementsprechend empfehlen wir, Abläufe, Systeme und Strukturen regelmässig hinsichtlich Kundennutzen, Kompatibilität mit den Unternehmenszielen, Effektivität und Effizienz kritisch zu überprüfen. Dabei geht es nicht nur darum, was verbessert, sondern vielmehr auch darum, was weggelassen werden kann. Mutige Entscheide führen oft zu einer stärkeren Fokussierung des Unternehmens und entlasten die Mitarbeiter.
Erfolgreiche Unternehmungen sind so komplex wie nötig und so einfach wie möglich aufgebaut. Dieses Gleichgewicht zu erhalten erfordert Wachsamkeit und kontinuierliche Arbeit. In diesem Sinne wünschen wir gutes Gelingen und stehen bei Bedarf jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Ziele müssen überprüfbar sein (November 2009)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Ziele sind im unternehmerischen Alltag von zentraler Bedeutung. Auch wir legen in unseren Projekten grössten Wert auf klare Zielsetzungen.
Ziele geben eine Richtung vor. Sie bilden die Grundlage für Entscheidungen zwischen verschiedenen Handlungsoptionen. Dank Zielen können Prioritäten bestimmt werden. Sie ermöglichen die sinnvolle Koordination unterschiedlicher Funktionen und Aktivitäten. Ziele erlauben Soll-Ist-Vergleiche und sind dadurch Voraussetzung für die Steuerung einer Unternehmung oder eines Projektes. Und: Ziele motivieren.
Damit Ziele diese Funktionen erfüllen können, müssen sie konkret formuliert werden. Ein Ziel beschreibt immer einen Endzustand – und zwar so präzis wie möglich. Zur Beschreibung gehören Zielinhalt, -massstab und -ausmass, der Geltungsbereich und der zeitliche Bezug. Anders ausgedrückt sind folgende Fragen zu beantworten: Was soll erreicht werden? Wie wird gemessen? Wie viel ist genug? Wo soll das Ziel gelten (Unternehmung, Sparte, Markt, Projekt, etc.)? Bis wann soll es erreicht werden?
Häufig wird obiger Grundsatz aber verletzt. Zum Beispiel wenn anstelle von Zielen Tätigkeiten beschrieben werden oder wenn die Zieldefinition zu vage oder unvollständig ausfällt. Mitunter fehlt sie ganz: Es wurden einfach überhaupt keine Ziele festgelegt.
Mögliche Konsequenzen sind Fehlentscheide, Konflikte mit entsprechenden Reibungsverlusten, Ressourcenverschwendung, Führungslosigkeit und Frustrationen. Es ist unschwer einzusehen, dass sich diese Folgen fatal auswirken können.
Die sorgfältige Formulierung von Zielen kann sehr aufwändig und anspruchsvoll sein.
Dies gilt umso mehr, wenn es sich dabei um einen Gruppenprozess handelt. Es lohnt sich aber, hartnäckig zu bleiben. Erfolge basieren in den allermeisten Fällen auf genau definierte Ziele. In diesem Sinne wünschen wir Beharrlichkeit und stehen bei Bedarf jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Weniger Fehler (September 2009)
Resultat einer ausgeprägten Fehlerkultur
Liebe Kunden, Partner und Freunde
In Unternehmungen, die über eine ausgeprägte Fehlerkultur verfügen, wird akzeptiert, dass Menschen Fehler machen. Die Schuldfrage ist von untergeordneter Bedeutung. Im Zentrum stehen das rasche Erkennen von Fehlern, die Analyse ihrer Ursachen sowie das künftige Vermeiden gleicher Fehler. Die Vorteile liegen auf der Hand: weniger Fehler und damit tiefere Kosten. Mehr Innovationen und damit ein Vorsprung gegenüber Mitbewerbern. Das wohl bekannteste Beispiel einer Firma mit einer herausragenden Fehlerkultur ist der japanische Automobilhersteller Toyota.
Trotz der unbestrittenen Vorteile lassen sich bei uns kaum Unternehmungen finden, welche über eine derartige Fehlerkultur verfügen. Denn ihre Einführung ist mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden und oft zum Scheitern verurteilt. Zu gross sind die Unterschiede zu den vorherrschenden Wertsystemen und lebenslang eingeübten Verhaltensnormen. Werden bei uns Fehler gemacht, ertönen in der Regel sofort die Frage nach den Verantwortlichen und der Ruf nach Sanktionen. Entsprechend sind bei Mitgliedern vieler Organisationen übertriebene Risikovermeidungsstrategien zu beobachten. Geht dennoch einmal etwas schief, wird verschwiegen, vertuscht oder anderen die Schuld in die Schuhe geschoben. Die Tatsache, dass die meisten von uns auf persönlicher Ebene nach Perfektion streben und darum Mühe im Umgang mit eigenen Fehlern bekunden, dürfte diesem Verhalten zusätzlichen Vorschub leisten.
Bleibt der Kulturwandel also eine Utopie? Wir glauben nicht. Es braucht aber den deutlichen Willen zur Erneuerung sowie Geduld und Beharrlichkeit. Diese Voraussetzungen finden sich am ehesten in Unternehmungen mit einer starken Eigentümerschaft. Inhaltlich ist unter anderem auf folgende Punkte zu achten, um die Erfolgschancen des Veränderungsprozesses zu erhöhen: Wecken des Problembewusstseins bezüglich der Kosten von Fehlern. Sensibilisieren für die Ineffizienz der angestammten Vermeidungs- und Verhehlungsstrategien. Hervorheben des Nutzens einer lernenden Organisation für Kunden und Mitarbeiter. Möglichst alle am Veränderungsprozess aktiv teilhaben lassen. Neue oder veränderte Erwartungen klar formulieren. Anpassung der Sanktionsmechanismen, indem beispielsweise nicht mehr der Fehler, sondern die unterlassene Meldung geahndet wird.
Der Weg zu einer neuen Fehlerkultur ist lang und wird Rückschläge mit sich bringen. Wir sind aber der Ansicht, dass der Nutzen die Kosten bei weitem übertrifft. In diesem Sinne wünschen wir viel Erfolg und stehen bei Bedarf jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Cash is King (Juli 2009)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
"Cash is King" lautet das Schlagwort der Stunde. Um den Zahlungsverpflichtungen nachzukommen, sind flüssige Mittel, sprich Cash, essentiell. Dies macht sich gerade in schwierigen Zeiten bemerkbar.
Kurzfristige Engpässe können durch Veräusserungen betrieblich nicht dringend benötigter Vermögenswerte oder durch Zuführung von neuem Kapital überbrückt werden.
Voraussetzung für die Veräusserung von nicht betriebsnotwendigen Vermögenswerten ist, dass solche überhaupt vorhanden sind und sich interessierte Käufer finden lassen. Dabei entsprechen die Preise, die gegenwärtig gelöst werden können, in den seltensten Fällen den Vorstellungen der Verkäufer.
Ähnliches gilt für die Zuführung von neuem Kapital. Erstens müssen Fremd- oder Eigenkapitalgeber gefunden werden, die bereit sind, Geld in die Unternehmung einzubringen. Zweitens schlägt sich die Dringlichkeit des Bedarfs in der Regel in den Konditionen nieder (wie z.B. hohe Zinsen oder Mitspracherechte).
Jeder Unternehmung erwachsen zunächst Ausgaben, bevor Einnahmen fliessen; dadurch entsteht eine Vorfinanzierung der Kunden. Deren Umfang wird durch die Debitoren, die Warenvorräte und die Kreditoren bestimmt (Nettoumlaufvermögen), ihre Dauer durch die entsprechenden Fristen (Cash-cycle). Die Reduktion von Umfang und Dauer der Vorfinanzierung bietet beachtliches Potential, die liquiden Mittel zu erhöhen ohne neue Kosten zu verursachen.
Die Massnahmen hierzu mögen banal klingen, werden in der Praxis aber oft sträflich vernachlässigt: Zahlungsfristen/Skonti der Lieferanten nutzen, Lager abbauen, Voraus- beziehungsweise Barzahlungen verlangen oder nach Leistungserbringung sofort fakturieren und ein sauberes Debitorenmanagement mit klaren Mahnprozessen führen.
Cash ist jedoch erst dann richtig King, wenn die Einnahmen dauerhaft grösser sind als die Ausgaben. Erfolgreiche Unternehmungen verfügen deswegen über entsprechend robuste Geschäftsmodelle. Sie sind die Basis für Unabhängigkeit, Flexibilität, Wachstum, Investitionen und somit für die nachhaltige Steigerung des Unternehmenswertes. In diesem Sinne wünschen wir viel Erfolg und stehen bei Bedarf jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Schlüsselfaktoren für den Projekterfolg (Mai 2009)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Bei Anpassungsprozessen in Zeiten von Veränderungen spielen Projekte für Unternehmungen eine zentrale Rolle. Jedes Projekt bedeutet per Definition Betreten von Neuland und beinhaltet Risiken. Oft entscheidet sich schon beim Aufsetzen eines Projektes, ob es erfolgreich sein wird. Nach unserer Erfahrung sind dabei sechs Faktoren entscheidend: der Projektgrund, die Projektziele, die Projektorganisation, die benötigten Fähigkeiten, die erforderlichen Ressourcen und die Projektkommunikation.
Der Projektgrund gibt dem Projekt Sinn und Zweck. Er beantwortet die Frage nach dem Warum und schafft ein gemeinsames Verständnis und grundsätzliche Orientierung.
Die Projektziele definieren den gewünschten Endzustand. Sie geben eindeutige Antworten auf die Frage, was bis wann erreicht werden muss.
In der Projektorganisation sind die Rollen des Auftraggebers, des Projektleiters und der Projektmitarbeiter klar zu bestimmen. Der Auftraggeber unterstützt das Projekt und die trifft die zentralen Entscheidungen. Der Projektleiter ist für die Steuerung des Projektes sowie für die Projektkommunikation verantwortlich. Die Projektmitarbeiter bringen Fachwissen und unterschiedliche Sichtweisen ins Projektteam ein.
In der Projektorganisation ist ausserdem dafür zu sorgen, dass Führungs-, Methoden- und Sozialkompetenzen vorhanden sind. Das erforderliche Fachwissen muss im Projektteam verfügbar oder bei Bedarf von ausserhalb abrufbar sein.
Jedes Projekt ist mit den notwendigen finanziellen und zeitlichen Ressourcen auszustatten. Hierbei wird die zeitliche Beanspruchung der Teammitglieder oft unterschätzt. Diese müssen genügend Kapazität freisetzen können, genauso wie der Auftraggeber, der genug Zeit dafür einplanen muss, das Projekt von Anfang bis zum Schluss adäquat zu begleiten.
Projekte bezwecken Veränderungen. Jede Veränderung weckt Ängste und Bedenken, die zu Widerständen führen können. Es ist die Aufgabe einer guten und ehrlichen Projektkommunikation auf diese Ängste einzugehen und sie möglichst aufzufangen. Gerechtfertigte Kritiken sind aufzunehmen, um das Projekt voran zu bringen. Projektkommunikation ist somit immer Zweiwegkommunikation.
Diese Elemente bilden die Grundlage jedes erfolgreichen Projektes. Die zu Projektbeginn in ein sicheres, tragfähiges Fundament investierte Zeit zahlt sich im Verlauf eines Projektes um ein Mehrfaches aus. In diesem Sinne wünschen wir gutes Gelingen und stehen bei Bedarf jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Strategieumsetzung mit Balanced Scorecard (März 2009)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Selbst trefflich formulierte Visionen und klare Strategien bereiten im unternehmerischen Alltag oft grosse Schwierigkeiten bei der Umsetzung. Die fehlende Verbindung zwischen der strategischen Ebene und dem Tagesgeschäft erweist sich dabei als das Hauptproblem. Denn strategische Unternehmensziele, wie beispielsweise das Erwirtschaften einer bestimmten Eigenkapitalrentabilität, können in aller Regel nur mittelbar erreicht werden.
Die Balanced Scorecard (BSC) hat sich als effektives Instrument etabliert, welches die Kluft zwischen langfristiger Ausrichtung und operativer Ebene überwindet und den Beitrag jedes Einzelnen zur Strategieumsetzung sichtbar macht.
Mit der BSC werden die strategisch relevanten Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge modelliert. Zunächst werden dabei vier wesentliche Perspektiven unterschieden (Finanzen, Kunden/Markt, Prozesse/Strukturen, Mitarbeiter/Systeme/Instrumente) und zueinander in Verbindung gebracht. Die folgenden Fragen dienen der Veranschaulichung: Was ist auf finanzieller Ebene vorzukehren, um das Ziel bezüglich Eigenkapitalrentabilität zu realisieren? Welche Marktziele sind zu erreichen? Was ist zu tun? Wie müssen dazu unsere Prozesse aussehen? Welche Prozesse sind überflüssig? Welche Fähigkeiten brauchen unsere Mitarbeiter? Sind Weiterbildungsmassnahmen nötig? Welche Instrumente und Systeme unterstützen unsere Mitarbeiter und Prozesse? Danach werden für jede Perspektive aus den Antworten auf die gestellten Fragen konkrete und überprüfbare Ziele definiert sowie entsprechende Massnahmen festgelegt. Daraus resultiert ein ausgewogenes Kennzahlensystem zur Steuerung der Unternehmung.
Durch dieses Vorgehen werden alle Unterziele und Aktivitäten von den strategischen Zielen abgeleitet und an diesen ausgerichtet. Die Verwendung der BSC erlaubt es, die Fortschritte bei der Strategieumsetzung gesamthaft zu überblicken. Abweichungen werden frühzeitig erkannt. Dementsprechend können Korrekturmassnahmen rechtzeitig ergriffen werden. Die interne und externe Kommunikation wird durch den Einsatz der BSC vereinfacht, weil diese Transparenz und ein gemeinsames Verständnis unter den Beteiligten schafft.
Erfolgreiche Unternehmungen zeichnen sich nicht nur durch eine klare Strategie, sondern insbesondere durch deren konsequente Umsetzung aus. Die BSC kann hierbei wertvolle Dienste leisten. In diesem Sinne wünschen wir viel Erfolg und stehen bei Bedarf jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Management von Unternehmenskrisen (Februar 2009)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Eine unternehmerische Krise zeichnet sich durch die existentielle Bedrohung einer Unternehmung aus. Sie ist der dramatische Höhepunkt vorangegangener Fehlentwicklungen. Die bisherigen Standardstrategien zur Problemlösung genügen nicht mehr. Die Lage ist durch grosse Unsicherheit gekennzeichnet. Dringlichkeit und Bedeutung von Entscheidungen steigen rapide an. Der Zeitdruck ebenso. Der Handlungsspielraum wird immer enger, während die Komplexität der anstehenden Probleme zunimmt.
Das wichtigste Ziel in einer solchen Situation ist, die Handlungsfähigkeit zu bewahren, beziehungsweise zurück zu gewinnen, also von der Reaktions- wieder auf die Aktionsebene zu gelangen. Die Komplexität ist soweit möglich zu reduzieren. Fokussierung auf das Wesentliche ist das oberste Gebot: First things first! Das bedeutet in der Regel auch die Anpassung des Reportings. Informationen müssen relevant, zeitnah und verlässlich sein. Denken in Szenarien erleichtert den Umgang mit der Unsicherheit. Harte Entscheidungen sind leider oft unumgänglich, gefolgt von entschlossenem Handeln. Die zentrale Rolle einer offenen, ehrlichen und klaren Kommunikation kann nicht genug hervorgehoben werden.
Bei akuten finanziellen Krisen sind die Prioritäten Liquidität, Stabilität und Rentabilität; in dieser Reihenfolge. Die Zahlungsbereitschaft (Liquidität) ist durch konsequentes Kosten-, Cash-, Rechnungs-, Debitoren-, Kreditoren- und Warenbestandsmanagement sowie gegebenenfalls durch kurzfristige Finanzierungen zu gewährleisten. In einem weiteren Schritt ist das langfristige Fundament der Unternehmung zu sichern. Die Kapitalstruktur (Stabilität) muss dem Geschäftsmodell entsprechen. Chancen und insbesondere Risiken eines zu hohen Leverage sind hinlänglich bekannt. Schliesslich ist dafür zu sorgen, dass die Unternehmung wieder langfristige Erfolgspositionen aufbauen und gewinnbringend arbeiten kann (Rentabilität).
Unternehmerische Krisen stellen grosse und äusserst belastende Herausforderungen dar. Sie können aber gemeistert werden. Dazu braucht es allerdings echtes unternehmerisches Handeln und authentische Führung in all ihren Aspekten. In diesem Sinne wünschen wir viel Erfolg und stehen bei Bedarf jederzeit gerne zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi
Kundenreklamationen – Wertvolle Informationen für das Management (Januar 2009)
Liebe Kunden, Partner und Freunde
Kundenreklamationen sollte es eigentlich gar nicht geben. Sie zeigen einen offensichtlichen Mismatch zwischen den Kundenerwartungen auf der einen Seite und der Leistung einer Unternehmung auf der anderen.
Die Realität sieht aber anders aus. Kundenerwartungen konkretisieren sich oft erst im Verlauf des Kaufprozesses und manchmal gar erst nach Empfang der Leistung. Ausserdem können sie sich im Verlauf der Zeit verändern, aufgrund von gemachten Erfahrungen oder durch Vergleiche mit anderen Anbietern. Auf der anderen Seite ist keine Unternehmung vor Fehlern gefeit, welche sich in den Produkten, der Auftragsabwicklung, der Auslieferung, der Fakturierung, etc. manifestieren können. Beanstandungen gehören daher zum normalen Unternehmensalltag.
Selbstverständlich sollte es Ziel jeder Unternehmung sein, möglichst wenige Kundenreklamationen zu erhalten. Die entscheidende Frage ist jedoch, was man aus diesen Beschwerden macht.
Dass Kundenreklamationen rasch und kulant behandelt werden sollten, ist mittlerweile allgemein anerkannt. Eine unkomplizierte, entgegenkommende Haltung wirkt sich in den meisten Fällen kostengünstiger aus als langwierige Streitereien. Zudem bietet sie die Chance, betroffene Kunden an sich zu binden und ein positives Unternehmensimage zu festigen.
Aus unserer Sicht gehören Kundenreklamationen zu den wertvollsten Informationen, welche eine Unternehmung überhaupt erhalten kann: ehrlich, direkt, konkret und dazu noch gratis.
Darum sollten sie für die ständige und nachhaltige Verbesserung der Unternehmensleistungen und -prozesse genutzt werden. Wir raten auch zu einer systematischen Erfassung (Problem/Anlass, Kunde, Bearbeitungsdauer, Weg/Kanal, Lösung, Resultat/Kundenzufriedenheit nach Bearbeitung, etc.). Damit lassen sich statistisch signifikante Rückschlüsse über die Art, Häufigkeit, zeitliche Kumulation, betroffene Kundengruppen, etc. von Problemen ermitteln, um den Hebel am effektivsten Ort ansetzen zu können.
Kundenreklamationen bieten Unternehmungen grosse Chancen, sich weiter zu entwickeln. Richtig genutzt ermöglichen sie es, nahe am Markt zu bleiben. Lernende Organisationen schaffen Mehrwert für ihre Kunden und heben sich von ihren Konkurrenten ab. In diesem Sinne wünschen wir viel Erfolg und stehen bei Bedarf jederzeit zur Verfügung.
Mit herzlichen Grüssen
Flavio Bertasi